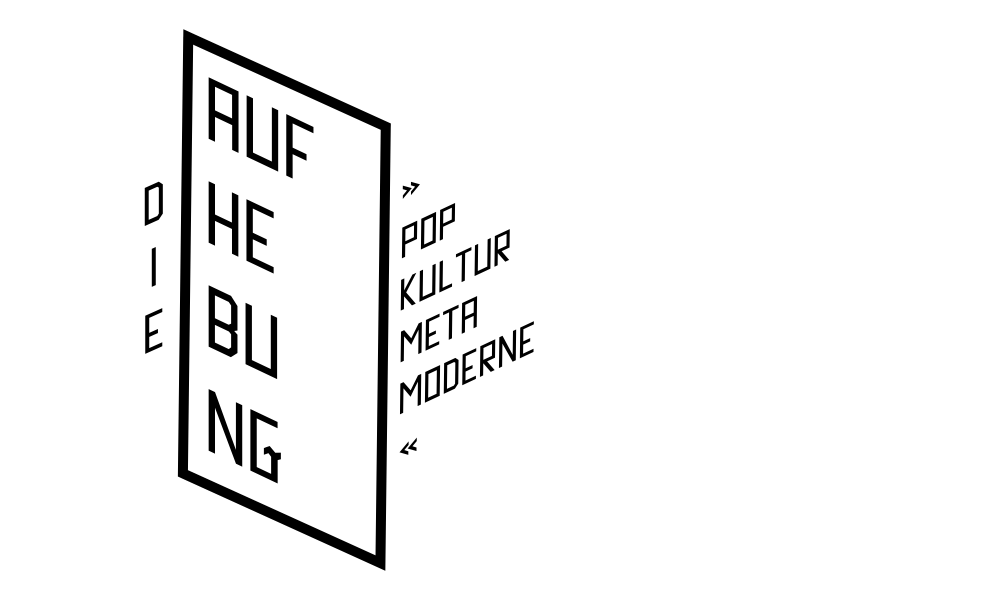Die Fassade der Portobello Road Nummer 265 wirkt unscheinbar. Das Haus ist im viktorianischen Stil erbaut: Drei Stockwerke, enge Eingangstür, ornamentierter Fenstersims, auf der Dachkante eine fingerdicke Schicht Taubenkot, die grauschwarz und schmierig dort klebt, wie um die letzten verbliebenen Fetzen Putz vor dem herabbröckeln zu bewahren. All das ist typisch für den Londoner Stadtteil Notting Hill. Vielleicht für die britische Hauptstadt überhaupt — vergilbte Überbleibsel imperialen Prunks, die dem schleichenden Verfall preisgegeben sind. Doch die breiten Flügeltüren im Erdgeschoss stechen heraus. Sie sind in grellem Gelb gestrichen. Darüber hängt an zwei aufwendig verzierten Stahlträgern ein schwarzes Schild: Mau Mau Bar. Hinter einem schweren roten Samtvorhang im Innern des Barzimmers versteckt, liegt der Veranstaltungsraum. Die Bühne, ein hexagonförmiger Bretterverschlag, ist so winzig, dass es schwer fällt, sich allein eine Handvoll Instrumente geschweige denn Menschen darauf vorzustellen. Und doch findet hier seit einigen Jahren jeden Donnerstag Jazz Re:Freshed statt. Die wöchentliche Konzertreihe von Adam Moses und Justin McKenzie hat sich inzwischen, zusammen mit Veranstaltungen des Café Oto im Ortsteil Dalston, zum Nukleus einer jungen Londoner Jazz-Szene entwickelt, die abseits der ausgetretenen Pfade des Genres nach neuen musikalischen Freiräumen sucht und dabei mit einer befreienden Unvoreingenommenheit zu Werke geht.
Dass sie dabei ausgerechnet im von der Gentrifizierung kaum verschont gebliebenen Notting Hill gelandet ist, hat zumindest in historischer Hinsicht Symbolwert: Nach Ende des Zweiten Weltkriegs galt das Viertel als erste Anlaufstelle vieler Einwanderer, vor allem aus der Karibik, die in der zerbombten Wiege des Empire dem Ruf nach Arbeit und einer gesicherten Existenz folgten. Doch die viktorianische Fassade täuschte: Allein die Wohnsituation war katastrophal; die größtenteils unsanierten Häuser wurden zimmerweise vermietet, sodass sich ganze Familien auf engstem Raum zusammengepfercht und der Willkür einzelner Hauseigentümer ausgeliefert sahen. Zudem schwelte unter den Teddy Boys in der britischen Arbeiterklasse bereits eine latente Abneigung gegen Einwanderer, die von neurechten Gruppierungen wie Oswald Mosleys Union Movement noch befeuert wurde und sich letztendlich in den Notting Hill race riots von 1958 bahn brach, bei denen über mehrere Tage hinweg Mobs bestehend aus bis zu 400 Personen Häuser von Migranten angriffen. Als Reaktion auf diese rassistisch motivierten Ausschreitungen organisierte die schwarze Bürgerrechtlerin Claudia Jones im Jahr darauf den Caribbean Carnival, der unter der Losung »a peoples art is the genesis of their freedom« stand, nicht zuletzt um damit zu verdeutlichen, dass Kultur – und das meint hier zunächst jene der afro-karibischen Diaspora – als Ausdrucksform emanzipatorischen Kampfes zu verstehen sei, es also um weitaus mehr ging denn Vergnügen. In den Folgejahren wurde aus dem Caribbean Carnival der bis heute alljährlich stattfindende Notting Hill Carnival. Dessen prägender Einfluss auf die britische Popkultur, insbesondere die aus Jamaika stammende Sound System-Culture, die in den Straßenzügen des Viertels eine zweite Heimat fand, ist kaum zu unterschätzen. Denn zusammen mit den Boxentürmen, Plattenspielern und MCs wanderten mit Reggae und Dub zugleich Musiken ein, die die britische Popmusik, allen voran Punk (man denke an die Veröffentlichungen auf Adrian Sherwoods On-U Sound Label) und später auch elektronische Ableger wie Drum & Bass nachhaltig beeinflussten. Die Suche nach kulturellen Wurzeln, so fragmentiert und übertüncht sie heute mitunter in Erscheinung treten mögen, und auch deren politische Ausdeutung prägen jenes Erbe, dem sich diese noch junge Szene annimmt.
Nur wenige Meter neben dem Eingang der Mau Mau Bar verläuft auf einer Überführung die M40 in Richtung Innenstadt. Folgt man ihr bis zum Regents Park und biegt dort links ab, erreicht man nach knapp dreißigminütiger Fahrt Brownswood Park. Dort, in einem ähnlich unscheinbaren Reihenhaus in der Brownswood Road Nummer 29, befindet sich seit knapp 12 Jahren das Hauptquartier von Brownswood Recordings. Es ist das Plattenlabel von Radio-DJ Gilles Peterson. In seiner Sendung Worldwide, die 1998 im Jugendprogramm BBC1 startete (das auch John Peel und dessen legendäre Peel Sessions beheimatete) und inzwischen jeden Samstagnachmittag auf BBC6 Music zu hören ist, bewegt sich Peterson seit beinahe zwei Jahrzehnten im Krebsgang durch die Musikwelt. Seine Vorlieben sind nahezu unüberschaubar breit gestreut und umspannen getreu dem Titel der Sendung beinahe den gesamten Globus — von kubanischer Clubmusik über britischen Acid Techno hin zu japanischem Free Jazz und Afrobeat. Dabei sind es insbesondere jene verborgenen Grauzonen, die sich zwischen verschiedenen Genres erstrecken, die er immer wieder mit der Finesse eines Trüffelschweins aufspürt. Dort, wo sich die Eindeutigkeit von Zuschreibungen verliert, ist Gilles Peterson selten weit entfernt. Seit der Gründung des Plattenlabels folgt es konsequent der Maxime seines Initiators, diesen musikalischen Hybriden einen Raum zur Entfaltung zu eröffnen. Das zeigten bereits die ersten Veröffentlichungen, darunter eine LP des japanischen Jazz-DJ-Kollektivs Soil & »Pimp« Sessions, macht sich aber auch im jüngeren Output bemerkbar, der einmal mehr Petersons Faible für experimentierfreudigen Jazz zur Schau stellt.
Viele der Musiker die Jazz Re:Freshed spielen sind in der einen oder anderen Konstellation auch auf Brownswood vertreten. Erst vor kurzem ist mit We Out Here ein Sampler erschienen, der viele Protagonisten der Szene versammelt. Darunter den Schlagzeuger Moses Boyd, der im vergangenen Jahr zusammen mit dem Saxophonisten Binker Golding Journey to the Mountain of Forever, ein von der Vorstellung einer möglichen Utopie beflügeltes Album veröffentlichte, dessen mitunter rauschhafte Qualität an Kamasi Washingtons The Epic erinnert. Ohnehin drängen sich musikalische Parallelen zu den jüngeren Entwicklungen in Los Angeles rund um Flying Lotus und auf seinem Brainfeeder-Label vertretene Künstler wie Thundercat, Kneebody oder Ras G auf. Vor allem teilen beide Szenen eine zu anderen Genres durchlässige Auffassung von Jazz. The Balance, Boyds Beitrag zum Sampler, eröffnet ein nervös um sich selbst kreisendes Referenzkontinuum von Ambient, Elektronika und Drum & Bass. Wie ein Fußabdruck lässt sich der Einfluss britischer Clubkultur in seinem Spiel erkennen. Es ist roh und körperlich, beinahe so, als könne man im Sound der Drums die Anspannung der Sehnen hören, die den Körper in Bewegung versetzen. Eine Anspannung, die sich mit den ersten unvermittelt herunterdonnernden Tönen aus Nubiya Garcias Saxophon beinahe eruptionsartig entlädt und den gesamten Track in kosmische Sphären hebt. Beide Musiker sind auch auf Brockley, einem Titel des Tubisten Theon Cross vertreten, dessen Melodielinie in ihrer knarzenden Schwerfälligkeit jedem Acid-Track zu Gesicht stehen würde. Cross wiederum ist Teil des irgendwo zwischen Fela Kuti, Sun Ra und Madlib oszillierenden Ezra Collective, dessen erste EP Juan Pablo: The Philosopher Ende vergangenen Jahres erschien. Darauf zu finden: Ein großartig zwischen überreizt dahinrasenden Drums und fast meditativer Versenkung balancierendes Cover von Sun Ras Space Is The Place. Neben Cross spielt darauf auch Joe-Armon Jones, dessen schillerndes Pianospiel viel Wärme aus Soul, R&B und Funk schöpft und damit jene Ebene der Konsistenz schafft, auf der sich sämtliche solistische Eskapaden, sei es in Polyrhythmik oder freier Improvisation, immer wieder begegnen.
Der musikalische Referenzrahmen, den der Sampler aufruft, verdeutlicht bereits, was das auf den ersten Blick eigenwillig anmutende Verständnis von Jazz innerhalb der Szene ausmacht: Musikalisch wird sich hier mit erstaunlicher Eleganz und Leichtfüßigkeit durch die vergangenen 60 Jahre vor allem schwarzer Popmusik, sowohl dies- als auch jenseits des Black Atlantic, wie ihn der Kulturwissenschaftler Paul Gilroy einst taufte, bewegt. Dabei ist der Zugang zum Material geprägt von einem erfrischend undogmatischen Eklektizismus: Wie selbstverständlich finden sich hier Einflüsse aus Space- und Spiritual Jazz à la Sun Ra, Herbie Hancock und John beziehungsweise Alice Coltrane neben Versatzstücken aus Hip Hop, Funk und technoideren Spielarten wie House oder Drum & Bass wieder.
Im Beiklang wird zudem vor allem eines deutlich: Die eigentliche Musik spielt abseits der Musik. Das Verweben, Gegeneinanderstellen und Abwägen all dieser Einflüsse ist immer auch Ausdruck einer Suche nach Identität. Dass die sich insbesondere in einer Einwanderungsgesellschaft wie Großbritannien immer schwieriger umreißen lässt und – sofern sie auf vermeintlich kulturelle Eigenheiten bestimmter Bevölkerungsgruppen abzielt – zugleich häufiger zum Leitmotiv rassistisch motivierter Konflikte wird, ist keine Neuigkeit. Was dieses Verständnis von Jazz im Gegenzug anbietet, stellt Identität vielmehr in Frage, als sie vorauszusetzen. Wie emblematisch für dieses Unterfangen steht Zara McFarlanes letztes Album Arise, das Ende vergangenen Jahres auf Brownswood erschien. Darauf spürt die Sängerin ihren karibischen Wurzeln nach: Mal ganz direkt im Roots Reggae, unter anderem mit einem unglaublich einfühlsamen Cover des Congos-Klassikers Fisherman; häufiger jedoch sind es aus Jamaika überlieferte Rhythmen, die – wie auf Ode to Kumina – mitunter religiösen Kontexten entstammen und hier ganz unvermittelt auf die wesentlich loseren Strukturen des Jazz treffen.
»It kind of came out of the idea of black history and blackness and feeling like you’re trying to find yourself« heißt es im Kommentar zur Platte. Hier wirft die Musik eine Frage auf, die schon den karibisch-britischen Kulturtheoretiker Stuart Hall zeitlebens umtrieb: Ist Identität nicht immer schon Komposition, wesentlich Vielheit nicht Einheit und mithin die Frage nach so etwas wie kultureller Essenz von vornherein falsch gestellt? Vielleicht offenbart die krampfhafte Fixierung auf sie vielmehr die Colonial Mentality, um es mit einem Titel des Ezra Collective zu fassen, des Suchenden. Dementgegen verbirgt sich die Stärke einer antiessenzialistischen Auffassung von Kultur, wie es der französische Philosoph Francois Jullien vor kurzem in einem Essay zur kulturellen Identität formulierte, gerade in der Eröffnung von Zwischenräumen oder Distanzen — Räumen also, die Platz für Kommunikation, Verhandlung, durchaus auch Uneinigkeit schaffen und damit fruchtbare Ressourcen der Kultur mobilisieren.
Dieses Verständnis von Jazz ist also eines, das die Vielfalt und vielfältigen Faltungen der Kultur tatsächlich zu leben und samt aller ihr innewohnenden Widersprüche auszudrücken versucht. Und diesen Jazz kann es wohl nur in Metropolen wie Los Angeles oder eben London geben, in denen all die identitätspolitischen Konfliktpotentiale in der Enge des urbanen Raums notgedrungen und nahezu ungebremst aufeinanderprallen, um mal mehr, mal minder gewaltsam die Auseinandersetzung mit ihnen einzufordern. So verstanden wird Jazz auch abseits der Musik zur Bewältigungsstrategie des Alltags und mithin jener Form des Empowerments, die Claudia Jones damals für den ersten Carnival in Notting Hill einforderte.
Weitere fünf Autominuten entfernt, im Stadtteil Stoke Newington befindet sich neben der Mau Mau Bar und Brownswood Recordings jener dritte Gravitationspunkt, um den die Szene kreist: Worldwide FM. Hier verliert sie den hoheitlichen Boden unter den Füßen, um im Äther des World Wide Web zu verschwinden und alsbald in sämtlichen Regionen der Welt wieder daraus aufzutauchen. Die Existenz der erst seit knapp zwei Jahren existierenden Plattform ist einmal mehr Gilles Petersons ans Pathologische grenzenden Ansporn zu verdanken, der diesen Radiosender nicht zuletzt als konsequente Erweiterung des selbstauferlegten Auftrags dachte, dieser mitunter doch einigermaßen sperrigen Musik Gehör zu verschaffen. Fast beiläufig reiht sich das Projekt mit dieser Intention in eine bis in die 1960er Jahre zurückreichende Tradition der Pirate Radio Stations (kleine Sender, die zunächst auf Kurz- und Mittelwelle von Schiffen außerhalb der britischen Hoheitsgewässer sendeten) ein, über die Popmusik überhaupt erst Einzug ins staatlich geförderte Radioprogramm erhielt, nämlich mit der sukzessive schwindenden Hörerschaft der alten BBC, die sich daraufhin neu organisierte und BBC1 bis BBC6 schuf. Sender wie Voice Of Africa Radio gaben insbesondere der afrikanisch-karibischen Diaspora in London eine Stimme und mithin die Möglichkeit, sich unabhängig und abseits der öffentlich-rechtlichen Kanäle über Community-relevante Themen zu informieren.
Neben Petersons – im Geiste an John Peel geschulten – Brownswood Basement Sessions hat auch Shabaka Hutchings eine eigene monatliche Sendereihe auf Worldwide FM. Der 1984 in London geborene und Barbados aufgewachsene Saxophonist/Klarinettist ist derzeit das wohl prominenteste Gesicht der Szene, was an seiner gefühlten Omnipräsenz liegen mag. Er spielt auf einem nicht unbeträchtlichen Anteil der Veröffentlichungen, die den Untergrund der Szene verlassen. Bisweilen ist er Teil des sich irgendwo zwischen Post Punk, Hard Bop, Afrobeat und, nun ja, Krach verortenden Kollektivs Melt Yourself Down und leitet zudem drei weitere Projekte: Shabaka & The Elders, The Comet Is Coming und Sons Of Kemet. Mit letzterem hat er kürzlich ein neues Album auf Impulse! Records, jenem inzwischen legendären Plattenlabel, das damals John Coltrane, Charles Mingus und Pharaoh Sanders zu breiter Öffentlichkeit verhalf, veröffentlicht, das den Titel Your Queen Is A Reptile trägt und in jedem Track eine Aktivistin der afrikanischen Diaspora würdigt, darunter Angela Davis, Anna Julia Cooper und Harriet Tubman. Inspiration für den Titel fand Hutchings auch in einem Sun Ra-Zitat, das sich auf das Verhältnis von Mythos und Unterdrückung bezog: Das erste, was Gesellschaften im Zuge ihrer Unterjochung verlören, sei die Fähigkeit, sich eigene Mythen zu entwerfen. Zugleich operiere das System der Unterdrückung jedoch selbst entlang mythologischer Strukturen, die vermittels der Macht als vermeintlich unhintergehbare Wahrheiten legitimiert würden. In Großbritannien ist es vor allem der Mythos des hereditary privilege, des qua Geburt in eine aristokratische Klasse vermittelten Anrechts auf soziale Vorrangstellung, den Hutchings in Frage stellen will, indem er gewissermaßen Konter-Mythologien konstruiert, die die willkürliche Natur dieser Strukturen ausstellen. Einmal mehr wird hier der an Claudia Jones’ Slogan knüpfende Impetus deutlich. Mithin scheint eine Affinität zur theoretischen Reflexion der eigenen Lebensrealität durch: Hutchings Beitrag zum We Out Here-Sampler – Black Skin, Black Masks – verweist im Titel auf eine Schrift des martinikanischen Psychoanalytikers Frantz Fanon, nämlich Black Skin, White Masks, der darin die Auswirkungen der Kolonialsprache auf die Psyche der Kolonisierten untersucht. Mit dieser Überlegung im Hinterkopf, ließe sich dieser Jazz vielleicht auch als eine Art musikalisch verfasste Sprache verstehen, die ein Projekt vorantreibt, das der kenianische Schriftsteller Ngūgī wa Thiong’o einst ›Decolonizing the Mind‹ nannte. Dann wäre dieser Jazz in seiner gesamten Verfasstheit – auch abseits der Musik – der Versuch, ein emanzipatorisch politisches Handeln zu entwickeln, das noch immer allenthalben vorfindbare Unterdrückungsmuster zu erkennen und mithin aufzubrechen versucht. In diesem Bestreben nehmen sich die Musiker dieser jungen Londoner Jazz-Szene des kolonialen Erbes an, das der Carnival Jahr für Jahr von neuem wieder aufruft. Vielleicht braucht es also gerade deshalb Orte wie das Café Oto oder eben jenen winzigen Bretterverschlag in Notting Hill: Um Räume der Öffnung und Kommunikation zu bewahren, verteidigen und auszubauen, inmitten einer Gesellschaft, die sich entlang der – vermeintlich nationalen – Kultur immer tiefer in verkrusteten Denkmustern und Mythen (des Alltags, wie der französische Theoretiker Roland Barthes wohl ergänzt hätte) verstrickt.
Text
Robert Henschel
Fotografie
© Pierrick Guidou
© Casey Moore
[accordiongroup][accordion title=“Hör|Spiel“]
[/accordion][accordion title=“Schau|Spiel“]
[/accordion][/accordiongroup]