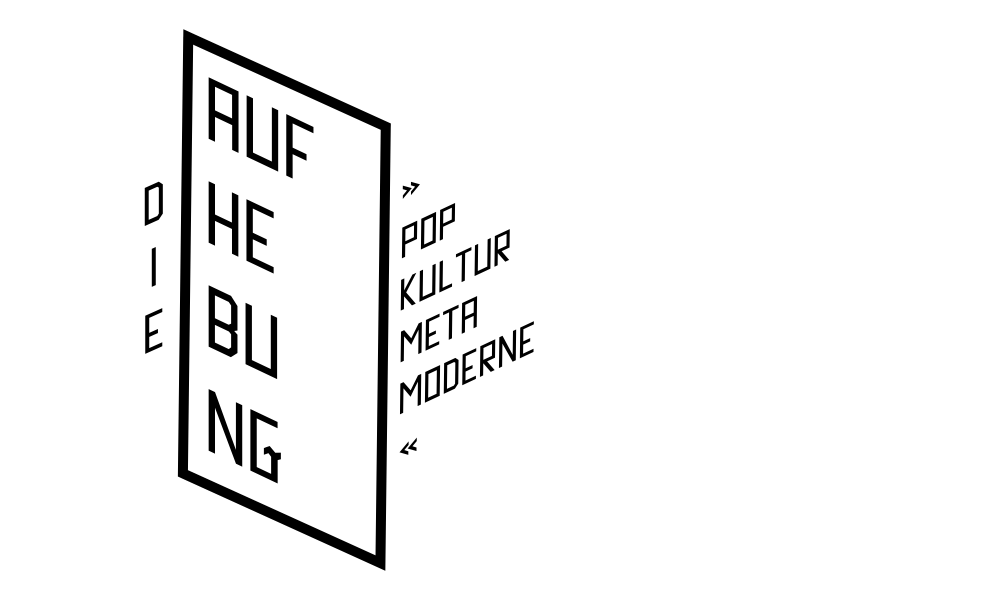Schwarz. Blackout. Weiß. Whiteout. Schwarz. Blackout. To black out. Wir alle kennen den Blackout. Plötzlich ist alles weg. Dunkel. Schwarz. Erinnerungsverlust. Blackout meint aber noch mehr. Versagen technischer Systeme. Versagen physiologischer Systeme. To black out meint Zensur. Auslöschen von Information. Blackout ist auch Vergessen. Auslöschen von Erinnerung.
Mikael Mikael 2015: 6
Seltsam ver-rückt irgendwie alles: Meine beste Freundin hat vor über drei Jahren überlebt. Mein Guter Freund ist plötzlich ins Krankenhaus gekommen. Der Fön weht durch die für Mitte Oktober viel zu warmen Straßen. Ein ICE ist ausgebrannt. Tagelange Streckensperrung. Ein Glück, nur vier Leichtverletzte. Passagiere scheinen sehr gut reagiert zu haben. Die Hotline und auch das Reisezentrum der Bahn sind zuvorkommend und helfend. Die Mama ist gut wieder daheim angekommen. Ich war in Kalifornien. California dreaming. Spex wird eingestellt. Nicht ganz. Intro war meine Studierendenbude. Die Fanzines die kohlebeheizte WG davor. Die De:Bug das ‚Big in Berlin‘-Sein danach. Aber Spex war mein Leben. Dort lernte ich produktives Antitum: „Dialektik meinte stets weniger logische Wissenschaft als eine Logik der politischen Kontroverse. Und als solche ist eine dialektisch motivierte Anti-Haltung die vielleicht einzige Denkform, die Widersprüche nicht nur negieren oder dekonstruieren, sondern auch aushalten kann – ja eine utopische Kraft aus ihnen zieht.“ (Sippenhauer 2018: 26) Am Kölner Hauptbahnhof fand eine Geiselnahme statt. Alles seltsam. Das notierte ich mehr oder minder irgendwann im Herbst 2018. Als ich endlich diese Kolumne weiterschreiben wollte. Das tat ich seinerzeit zunächst dann nicht. Und es sollte alles noch viel seltsamer werden.
Zu viel Wirklichkeit in zu wenig Zeit.
Pausch, Raether & Ulrich 2020: 3
Nun nämlich, Ende März, Anfang April 2020, notiere ich: Physical distancing ist das Gebot der Stunde, social distancing als Begriff der größte Quatsch, denn wir wollen ja in jeder Hinsicht so social wie möglich sein. Der Virus ist da (vgl. Ulrich 2020, Assheuer 2020, Pausch, Raether & Ulrich 2020). Mein guter Freund Wolfgang sagte gestern beim Tele-Bier, er habe das Gefühl, dass da etwas Anderes käme, etwas Besseres. Slavoj Žižek rief in der „Kulturzeit“ auf 3sat das Ende des Kapitalismus aus. Die Gesellschaft der Angst (Heinz Bude) und der Monaden kann zur Gesellschaft des Muts und der Dorfplätze werden. Kann. Der Kollateralnutzen (Paul Nolte) wäre das – auch für die letzte Verzweifelte und den limitierten Extremisten – Überflüssigwerden populistischer Blender-Parteien, die schlichtweg keine dieser komplexen Welt zwischen Globalisierung und De-Globalisierung angemessenen Lösungen in petto haben; genau genommen gar keine Lösungen, sondern nur tumbes Krakeelen anbieten (vgl. dazu auch die Veranstaltungsreihe „Druckwellen. Fühlen & Denken“ an der Universität Paderborn und die dazugehörigen Publikationen, die teilweise noch in der Mache sind).
Vor 20 Jahren schrieb ich in einem Sammelband zu neuen Reality-Formaten im TV doch etwas ungeordnet und wissenschaftsjungwildernd vom Bedarf an großen neuen Schocks in unserer verwöhnten Spaßgesellschaft (vgl. Jacke 2000). Gar nicht so apokalyptisch gemeint, eher ein sehr nachdenkliches Plädoyer ob der großen persönlichen und gesellschaftlichen Erschütterungen, die die Generationen meiner Großeltern und Eltern erlebt hatten – aus denen sie dann übrigens u.a. mit Jazz, Musical, Literatur, Film, Radio und den Beatles herausfanden. Während wir Spätsechziger, Frühsiebziger unsere ‚Schlachten‘ spielerisch und stellvertretend von einer Fußball-EM oder dem Fernsehformat „Big Brother“ erledigen ließen. Die Idee war gut, die Formulierung war es eher nicht und auch stets ein bisschen ostentativ postpunkig-provozierend. Alles mit Vokabeln wie ‚Krieg‘ oder ‚Schlacht‘ viel zu martialisch und im Prinzip auch falsch tituliert und etwas unausgegoren, nicht weil ich den 11.09.2001 nicht hatte vorausgesehen, sondern weil ich doch etwas im eigenen Leben vergessen hatte, was so gar nichts mit den Bundeswehrstubenplakaten von den Pixies, My Bloody Valentine oder Union Carbide Productions (mussten abgehängt werden) zu tun hatte: Die Golfkriege, den Realitätsschock, als opportunistischer Ex-Wehrdienstleistender nunmehr in einen echten Krieg verwickelt werden zu können und die dementsprechende nachträgliche Verweigerung. Da war sie doch, die Realität. Und genau darum ging es eigentlich in meinem Essay, nicht um mörderischen Krieg, sondern um existentielle Krise. Gleichwohl kommt die „Apocalypse, not now“ (Ulrich 2020) in Form einer „Heimsuchung“ (Assheuer 2020) erst jetzt so richtig und über uns alle – auch in den Medienkulturgesellschaften. Wie ein schlechter oder doch auch guter Science Fiction-Film. „Ich kenne das Leben, ich bin im Kino gewesen“ aus dem Song „Grauschleier“ von Die Fehlfarben könnte nunmehr angesichts zukünftiger Filmproduktionen umformuliert werden: Ich kenne das Kino, ich bin im Leben gewesen. Die Umkehrung der Verhältnisse könnte tatsächlich mit Wolfgangs Formulierung etwas Besseres entstehen lassen, per sofortiger Entkommerzialisierung der Bereiche Gesundheit, Ernährung, Wohnen, Klima und Bildung etwa, per Transformieren in einen partizipativen Sozialismus (Piketty 2019: 1185-1271). Nur so scheinen wir das Badiou’sche ungeheuerliche Ungeheuer, welches nun auch noch einen natürlichen Virus evoziert haben könnte, bändigen zu können und daraus positive Folgerungen ziehen: „Ich denke, es ist absolut notwendig, dass wir etwas Neues schaffen, etwas, das sich auf der Seite der Gleichheit und Universalität befindet.“ (Badiou 2017: 47) Der Weg scheint nicht nur durch die aktuelle natürliche Abwehrreaktion in Form eines Virus mehr als vorgezeichnet: „Kollektivismus gegen Privateigentum, polymorpher Arbeiter gegen Spezialisierung der Arbeit, konkreter Universalismus gegen geschlossene Identitäten und freie Assoziation gegen den Staat.“ (Badiou 2017: 51) Und also aktuell: „Ausgangssperren drohen, die Wirtschaft ist lahmgelegt. Das bringt enorme existenzbedrohliche Nachteile für viele mit sich. Es zeigt aber auch, dass ein Stopp grundsätzlich möglich ist, dass wir wesentliche Aspekte wie Gesundheit, Solidarität und Rücksichtnahme in den Fokus rücken könn(t)en und damit sogar die Natur eine Atempause erhält. Die permanente Beschleunigung könnte mit diesem aus der Krise gewonnenen Wissen neu gedacht werden.“ (Günzel 2020b: 46)
Und auch wenn gerade alle zu Recht nach vorne schauen, vor dem Ungeheuer und der „schlechten alten Zeit“ (Ferlinghetti 2005: 223) weglaufen und bangen, wann und wie wir diesen Virus in den Griff bekommen, sich sorgen, hoffen, dass die Welt eine lebenswertere und gerechtere wird, möchte ich, wenig popsnobistisch und vielmehr die Schockstarre nutzen und auch zurück schauen auf eine Menge toller Alben und Compilations der letzten Jahre. Denn die größte Stärke der Popmusik ist es bekanntlich, Trost spenden zu können, weniger betäuben – obwohl, ja, manchmal auch das (vgl. Theweleit 2018) – als vielmehr einen virtuellen Ort des Umarmens und Mitreißens zu generieren. Popmusik kann virtuell und dennoch wirkungsvoll als Freund/in sein (vgl. zu Konstruktionen von Popmusik und/als Heimat Jacke/Mendívil 2019). Dafür, für eine eigene und gemeinsame Verortung, machen wir das doch alles auch irgendwie und werden mit und durch die popmusikkulturellen Brillen zu wichtigen Gesellschaftsbeobachtenden jenseits überkommener Differenzen: „Das Einstürzen der traditionellen E- und U-Differenz ist hier deshalb keine Frage des Niveaus. Das wäre von den alten Hochkulturen hergedacht. Auch markiert es keinen Perspektivenwechsel von ‚werkbezogen‘ zu ‚rezeptionsbezogen‘, von ‚formalistisch‘ zu ‚kritisch‘ oder Ähnliches. Stattdessen gibt es, seit die Künste über eine (elektro-)technisch-mediale Seite verfügen, einfach andere ästhetische Valeurs – ohne dass die alten aber deshalb gleich verschwinden würden. Bloß dreht sich nun nicht länger alles entweder um leichte Unterhaltung, Mitsingen, Tanzen, Schmunzeln und Rührung oder um Reflexivität, Katharsis, Durcharbeiten und Erschütterung, sondern stets und vor allem – nämlich an jener zentralen Schnittstelle, wo einst Formulierung, Artikulation und Expression wirkten – um den Index, also gleichsam um die Direktübertragung einer anderen Menschenseele vermittels der technischen Aufzeichnung ihres Körpers, zumal in dessen unwillkürlichen Momenten. [Hervorh. i. O., Anm. C.J.].“ (Diederichsen 2017: 11) Und so sind nicht nur die nachpopulären Künste (Diederichsen) auf eine spektakuläre Art gewöhnlich geworden. Klar verlieren sie damit eine Außergewöhnlichkeit, ihre Einsprüche kommen eben nicht mehr von außen, sondern sind integriert, aber nicht kraftlos, ihre Wirkungen können vorteilig, nachteilig, egalteilig sein. „Pop ist immer beides: Der Raum der Wünsche, Hoffnungen und Wahrheiten, [sic! Anm. C.J.] und das Schlachtfeld der Interessen, Macht und Entziehung des Wirklichen. Er ist die Comfortzone der großen Bejahung und das Archiv der möglichen Negationen.“ (Seeßlen 2018: 223). Schauen wir also gerne gemeinsam auf die bei mir angesammelten Alben, die sozusagen neben woanders rezensierten Platten und neben auch so vielen langweiligen Alben übrig geblieben sind – die sich bemerkbar gemacht haben und angesichts aktueller Krisenszenarien auf einmal aus dem Regal ins Ohr und auf den Schreibtisch sprangen.
From now on and very close: Popmusik und (Weiter-)Leben
Demgegenüber verbreitet sich jetzt existenzielle Unsicherheit global und gleichzeitig, und zwar in den Köpfen der medial vernetzten Individuen selbst.
Habermas 2020: 22
Drei Jahre hat dieser neue Teil gebraucht. Das heißt nicht, dass ich drei Jahre daran geschrieben habe. Wobei ich die meiste Musik in den Jahren 2017/2018 und nun aktuell wieder herausgesucht habe, nicht ganz weiß, wo 2019 eigentlich geblieben ist, außer in Australien, Istrien und meinen Rezensionen und Artikeln des Jahres und mich freue, jenseits irgendwelcher Marktmechanismen, Einschnitte und Katastrophen nun doch noch über ein paar fast schon wieder in Popzeitrechnung alte, neue und neu aufgelegte Alben schreiben zu können, über Musik, die mich in bewegten Zeiten bewegt. Es macht Spaß, gar nicht mehr darauf zu achten, ob dies jeweils die aktuellsten Alben sind, es löst sich alles los – nicht auf.
Zwei Schritte zurück: Nachdem im ersten Teil einer sehr umfassenden und ergiebigen Werkschau über frühen Proto-Synth-Pop, DIY Techno und Ambient Exploration (so der Untertitel) der Siebziger und Achtziger in UK („Close To The Noise Floor“ (siehe Teil 5 meiner hiesigen Kolumne) ist dasselbe Anliegen inzwischen auch für den kontinentaleuropäischen Raum, sozusagen von Norwegen bis Griechenland, erschienen. Ebenso in einer 4er-CD-Box und üppig garniert und kommentiert werden hier bekannte und auch rare Stücke früher Electronica von 1974-1984 ausgegraben, wieder- oder weiterbelebt und hoffentlich für viele auch neu präsentiert: → Noise Reduction System: Formative European Electronica 1974-1984. Dabei treffen 62 Tracks aus einer einflussreichen Dekade aufeinander, die bei genauerem Hinhören und Hinsehen ganz klar zusammenhängen, Geschichten des Klangs, der Bilder, der Lyrics und der Performances bilden: Kultürlich haben DAF, Malaria, Der Plan und Yello Acts wie Klaus Schulze, Asmus Tietchens, Cluster oder Vangelis wahrgenommen. Kultürlich wussten Front 242, The Neon Judgement, Die Form und Borghesia, wer DAF und Yello waren. Besonders gefällt der Ansatz, nun nicht wieder die größten ‚Hits‘ dieser Musiker*innen abzufeuern, sondern mal links und rechts des Erwartbaren zu schauen und entweder auch mal etwas in Vergessenheit geratene Bands wie Die Gesunden mit ihrem großartigen Song „Die Gesunden kommen“ oder nicht so oft gehörte Stücke wie „Glue Head“ von Yello anzubieten. Die Archive sind voller toller Stücke, es macht Spaß hier einzutauchen, zu diggen und auch manch alten oder neuen Fremdscharm einfach mal zuzulassen. Ein einleitendes Essay des Sounds-Autoren Dave Henderson, Sleevenotes von Musiker*innen und Biograph*innen sowie zahlreiche Fotos machen die Box zu einer Fundgrube nicht nur für Post Punk- und New Wave-Fans, sondern auch für offenohrige Journalist*innen und Popmusikhistoriker*innen.
Mark E. Smith ist tot. → The Fall leben weiter. Ihr xtes Album New Facts Emerge ist zwar schon älter als Smiths Davongehen, aber knallt ins coronaeske Hier und Jetzt, dass es mir eine verbitterte Freude ist. Die Galle kommt wieder hoch, wenn sie überhaupt noch da ist. Gerade erst das tolle Seitenprojekt Von Südenfed mit den Marsmäusen wiederentdeckt und gesehen, dass deren Andi Thomas nochmals vor allem sprachliche Smith-Reste aus den Sessions für ein eher experimentelles Album verwendet hat, da komme ich endlich zum Anhören dieses dann wohl letzten Fall-Albums zu Lebzeiten. Ich liebe es, auch ohne Totenbonus, der Smith sicherlich eh nur süffisant gefallen würde. Bitte reinstürzen in diese polternden, fordernden Songs. Es ist eben nichts in Ordnung, und das hat dieser Typ mit seinen unzähligen Bandversionen von The Fall und anhand absurder Mulche (vgl. Fisher 2017: 42) seit jeher um die Ohren gehauen, höre etwa gleich nach dem Intro „Fol De Rol“ oder das wirklich ohne noch ein ‚post‘ eher postpunkige „Brillo De Facto“. Wie können sechseinhalb Minuten so kurzweilig und nicht genug sein? Was für ein grauschwarzer Monolith, der hier verbiestert, schräg und doch schlichtweg treibend durchs Dorf peitscht, und zwar keine Sau, sondern die Idioten. „In jedem Fall gibt es hier Gelächter, eine wilde Art der Parodie und des Spotts, von der man zögert, sie Satire zu nennen, vor allem in Anbetracht der blassen und zahnlosen Form, die die Satire in Großbritannien in den letzten Jahren angenommen hat. Bei The Fall scheint es hingegen, als sei die Satire an ihre Ursprünge im Grotesken zurückgekehrt. Ihr Gelächter stammt nicht aus dem gesunden Menschenverstand des Mainstreams, sondern aus einem gleichsam psychotischen Außen.“ (Fisher 2017: 40-41) Ich verneige mich. Vor Smith und vor Fisher.
Anders als Mark E. Smith und doch zur selben Zeit und mit ähnlicher Haltung entstanden waren Dan Treacys → T.V. Personalities. Britischer im Sinne von schimpfend-bitterböser ironischer Arbeiterklassenattitüde geht es kaum. Bis heute. Ja, die Sleaford Mods haben The Fall und Television Personalities sicherlich wahrgenommen. Smith ist tot. Treacy am Arsch. Jedenfalls weckt eine schnelle Recherche inklusive des Anschauens einiger Fernseh-Dokus diesen Eindruck. Wie dem auch sei, der ‚Part Time Punk‘ Treacy hatte einst zwischen 1990 und 1991 mit dem großen, bunten Spielkind des Art School Punk, Jowe Head (Swell Maps, später Palookas, vgl. auch Jacke 2016b) ein Album, oder besser diverse 4-Track-Sessions featuring Drum Box aufgenommen, welches endlich als Beautiful Despair veröffentlicht wurde. LoFi wird hier großgeschrieben, sicherlich nicht nur als technische Begrenzung. Sondern als Einstellung zur Welt. Treacys und Heads Minihits wie „Hard Luck Story Number 39“ oder „Goodnight Mr Spaceman“ lassen Einen kleine Tränen vergießen und doch auch schmunzeln. Farbenfroh und doch black-and-white. Vielleicht ist dies genau der passende der Soundtrack zur unsicheren Zeit.
Noch so eine wegweisende und mittlerweile anscheinend etwas gestrandete Gestalt ist Lawrence Hayward, der mit seiner nie wieder formierten Band Felt die wohl schönsten Indie Pop-Alben neben den Smiths und Jacobites produziert hat. Irgendwann benannte sich Lawrence gewissermaßen nur noch um, schien mehr als genug zu haben vom Indie-Fame. Auch hierüber gibt es eine 2008 produzierte bewegende Dokumentation namens „Lawrence of Belgravia“, die vor einigen Jahren als DVD aufgelegt wurde und die die ganze Tragik dieses großen und offenbar dauerangeschlagenen Songwriters einfühlsam darstellt. Seit 1999 firmiert Hayward u.a. auch als → Go-Kart Mozart (mit Terry Miles, der auch bei Primal Scream und den Jacobites spielt), mit den 17 neuen Songs auf Mozart’s Mini Mart gab es 2018 einen ganzen Shop voller Ideen, freilich mehr indie-bombastisch als so folkig-zurückgezogen wie bei Felt. Das bei Hayward seit jeher wichtige Artwork und Design (siehe die Doku) deutet irgendwie auf Grebo-Zeiten der späten Achtziger und frühen Neunziger hin, der Sound ist weniger Indie Folk wie bei Felt oder Post Punk wie bei The Fall oder Television Personalities, sondern eine bonboneske Mischung aus Synthie Pop, Indietronics and irgendwo tatsächlich noch British Rave und Grebo. Talking about: Erinnert sich noch jemand an Pop Will Eat Itself? Was für ein Name ist das denn alleine schon… Und diese hatten in ihrer nicht nur partiell persönlichen Birminghamer Verquicktheit und verrückten Britishness gleichermaßen Verbindungen zu düstertraurigem Folk der Jacobites ebenso wie zum Heroin-Dream Pop der Spacemen 3. Genau dazwischen befanden sich meines Erachtens Haywards Projekte auch immer. Noch immer schreibt Hayward Ohrwürmer wie das fröhliche „When You’re Depressed“. Schluck.
Und noch ein alter weißer Mann: → Chris Carter. Die Beschreibung wird ihm hoffentlich nicht gefallen. Zusammen mit seiner langjährigen Partnerin Cosey Fanni Tutti hat er als Chris & Cosey sowohl Synthie Pop-Geschichte geschrieben als auch den offenhörbar poppigen Part der legendären, nun so gar nicht populären Throbbing Gristle abgegeben, die bekanntlich vor einigen Jahren mit dem fulminanten „Desertshore/The Final Report“ noch einmal 2012 ein gewaltiges Statement abgegeben haben, als ihr Mitglied Peter „Sleazy“ Christopherson schon verstorben war. Nun ist auch Genesis Breyer P-Orridge vor einigen Wochen gegangen. Wieso spielt hier eigentlich der Tod so eine große Rolle in dieser Kolumne? Weil Pop historisch oder weil Musiker*innen und Kolumnist älter werden? Jedenfalls sind diese 25 Miniaturen auf Chris Carter’s Chemistry Lessons Volume One bezaubernd leicht und oft fast schwebend zwischen frühem Modular und Synthie Pop sowie späten SciFi-Filmmusiken. Klaus Schulze und John Foxx winken. Ziemlich erstaunlich im Sinne von staunen lassend. Kultürlich wabert die ganze schillernd-dunkle Popgeschichte von Carter im Hintergrund mit. Warum auch nicht.
Von jungen, nur scheinbar kalten Mulchen und Mulchinnen
So viel Wissen über unser Nichtwissen und über den Zwang, unter Unsicherheit handeln und leben zu müssen, gab es noch nie.
Habermas 2020: 22
The Moral Crossing haben → Autobahn selbst produziert, was dem Quintett aus Leeds sehr wichtig ist. Craig Johnsons durchaus anklagender Sprechgesang erinnert sicherlich auch an die oben genannten alten Männer, ist aber deutlich jünger zu verorten. Wobei die kulturelle zentrale Kategorie Alter eventuell an Gewicht verlieren kann, scheint es doch einerlei, welchen Alters der Mulch ist. Beinahe jedenfalls. Gehetzte Songs wie „Obituary“ oder „Future“ wirken wie kalter Regen von der Seite und lassen postpunkige Stürme wieder oder neu aufziehen, durchaus mit sonnigen oder zumindest aufhellenden Momenten, wie schon beim Debüt „Dissemble“ aus dem Jahr 2015 (siehe Teil 4 meiner hiesigen Kolumne).
Deutlich entschleunigter und wärmer geht es auf den wundervollen beiden ersten Alben Great Big Blue und My Resignation des Duos → Geowulf zu: Mit „Saltwater“ hatten sie gleich zu Beginn bereits einen Hit, der einen, nun ja, „Corona“-Werbespot des gleichnamigen mexikanischen Biers begleitete und nunmehr nie mehr so unbeschwert wirken wird als wie zuvor. Dieser tolle Song braucht den Werbespot ja eigentlich auch gar nicht. Und der Spot auch nicht mehr den Song, denn der Spot wird nicht mehr wirken wie er sollte. Anyway, „Saltwater“ ist für mich vollkommen coronafrei ein einfach traumhafter Ozeanwellensong. Das Info schreibt von einer Mischung aus Lana Del Rey und den übermächtigen Mazzy Star, das ist gewagt, trifft den Vergleichston aber doch auch sehr gut. Dave Roback (Mazzy Star, Opal) ist tot. Seine Musik bleibt. Geowulf machen da schon auch mit ihren beiden bittersüßen Alben weiter. Wobei „My Resignation“ fast etwas zu glatt bzw. vorhersehbar und „Great Big Blue“ noch ein sympathisches Stückweit rumpeliger klingt. Das Leben ist nicht gut, aber dann doch. Einst. An der australischen Ostküste, da, wo Star Kendrick und Toma Banjanin via London auch herkommen. Da will ich wieder hin. Naja, demütiger formuliert, möchte ich dort wieder hin. Wenn Mutter Erde es zulässt. Mit Dir? Und diese Songs hören. Die meisten. Und Mazzy Star. R.I.P. Dave, go on Geowulf.
So wie Geowulfs „Saltwater“ ist → Rides „Lannoy Point“ ein Übersong, ein Lied, das eine/n nicht mehr loslässt, packt, schüttelt, durch und durch geht, auf jeden Mix und jede Playlist gehört. Ride und vor allem deren Stimmen Mark Gardener und Andy Bell waren ja so etwas wie die Schnittstelle im postpunkigen Shoegazing zwischen The Jesus and Mary Chain, Primitives, Spacemen 3, My Bloody Valentine, Loop und dann aber auch dem bunteren ganzen Brit Pop à la Verve und Oasis. Wie das bei manch einer Begegnung im Leben so ist, beim zweiten oder dritten Blick, hier also sogar erst beim Comeback-Album der Briten, werde ich nochmal so richtig aufmerksam und genieße dieses ganze feine Album um so mehr. Auch der Zweitling des Comebacks, This Is Not A Safe Place, knüpft da durchaus an, mal mit federleichtem Frühlingssound („Future Love“, „Shadows Behind The Sun“), mal mit eher von Feedback und Grollen erfüllten Stücken („Kill Switch“, „R.I.D.E.“), dann wieder schleichend-verhuschten Psychedelic-Balladen („Eternal Recurrence“, „Dual Up“). Über allem schwebt aber eben für mich dieses einmalige „Lannoy Point“.
Und wenn wir hier schon über Über-Hits sprechen, darf „Archie, Marry Me“ aus dem ersten Album der kanadischen Band → Alvvays nicht fehlen. Dieser Indie-Hit schlechthin hat uns 2014 und seither zum Tanzen bewegt und zu Tränen gerührt. Auf ihrem Zweitling Antisocialites genügen den Musiker*innen aus Toronto 33 Minuten. „In Undertow“ schlufft gleich mitreißend los. Dream Pop mit Bonbons, ganz viel Hall und Mut zum auch mal Naheliegenden lullt uns gleich wieder positiv ein, Mitleid ja, Selbstmitleid nur ein bisschen. Ich mag dieses feierliche Leiern und Stolpern, wie es in letzter Zeit derart perfekt nur die Alvvays um Molly Rankin erzeugen. „Dreams Tonite“ hören und zuckend träumen. Stiefeletten an und ab auf den Tanzboden, der aktuell dann doch wieder das einsame Wohnzimmer ist. Schnell noch ein alkoholfreies Bier dazu und ab geht die lonesome Groove-Post.
Etwas ausgepowert falle ich nichtbetrunken-betrunken aufs neue, vor Corona angeschaffte Eck-Sofa. Das, auf dem ich mit ihr saß. Im Dezember. Wie ein Traum. Jahrhunderte scheint das her. Jetzt zu mir kommen. Bei mir bleiben. Und neben Liz Harris (Grouper, Nivhek), die das schon damals ganz besonders durfte, nun nochmal → Zola Jesus aka Nika Roza Danilova an meine Ohren und Hirnareale heranlassen (zu Grouper siehe Teil 3 dieser Kolumne). Vielleicht auch an mein Herz. Die Dame aus Phoenix ist knalliger als Harris, gleichwohl immer noch sehr schwelgerisch. Nicht umsonst heißt ihr mittlerweile auch schon sechstes Album Okovi auf Deutsch übersetzt „Fesseln“. Gerade eben genug Pathos, um nicht pathetisch zu wirken. Wobei Zola Jesus schon dick auftragen kann. Dann wieder im Ansatz antineoklassizistische Bässe. Zappeliger, synthetischer als die entrückten Tracks von Nivhek und gar nicht so gothic oder wavig, wie immer wieder behauptet wird, bei allem „Ash To Bone“, so ein Songtitel. „You should know I would never let you down“ („Soak“). Hm. Nun ja. ‚If you say so‘.
Es wummst jetzt aber mal hier. Denn metallern und nicht Heavy Metal-mäßig knallen die kanadischen Herren von → Metz mit ihrem dritten Studioalbum Strange Peace (mittlerweile gibt es noch eine offizielle B-Seiten- und Raritäten-Compilation aus 2019) in den sonnigen virulenten Alltag: BAM! Oder besser KLIRR! Wenn die Cosmic Psychos eine Walze waren, sind Metz der gigantische Presslufthammer. Sie schreien, sie ballern, ohne zu schießen. Sie werfen sich nicht auf dich, sondern reißen dich in den Graben, in dem der Matsch winkt. „Mess of Wires“ hören und die virulente Sonne scheinen lassen. Metz bauen auf, indem sie niederreißen. Früher war alles nicht besser. Ich habe das mal „früher war alles scheißer“ genannt beim Auflegen, aber das ist nicht fair. Denn früher war alles wie früher. Und früher ist alles wie ich es jetzt empfinde. Insofern ist jetzt auch nicht alles besser als früher. Metz machen die Synapsen tanzen oder vielleicht besser pogen. Aber pogen über 50jährige? Ist das verantwortlich? Also, sophisticated Pogo, nicht heavily drogenabhängig oder punkerspießig (zu Metz siehe auch Teil 4 dieser Kolumne).
Ganz ähnlich funktionieren die beiden neuen Alben von → No Age, aber wenn Metz eher Big Black (organischer, vgl. auch Jacke 2016a), Helmet (erste Generation und schneller), Dead Kennedys (noise-rockiger) oder Tar (schneller) sind, dann ziehen No Age einen Faden zu Sonic Youth (dreckiger) oder Live Skull (schneller). Bei No Age klirrt es auch, gleichzeitig knallt es weniger im Sinne von Noise Rock. Lawinen rauschen hier schon auch den Hang herab, aber sie sind voller Blumen. Beide Alben sind bei „Drag City“ erschienen, was adäquat erscheint. Und alle 23 Songs von Randy Randall und Dean Allen Spunt machen enorm Spaß, kugeln an einem vorbei, transportieren mehr Beach Boys, Hüsker Dü oder Wedding Present in dieser typisch US-amerikanischen College-Variante, das meine ich mit den Blumen. Dabei haben No Age aus L.A. ganz klar ihre Lektion Velvet Underground und Feelies im kalifornisch-surfenden Rucksack (ganz deutlich etwa auf „Sandalwood“ von Goons Be Gone).
Zu Metz und No Age passen die neuseeländischen →Wax Chattels bestens: Nicht nur teilen sie ein postpunkiges und indie-poppiges Kult-Label, denn „Flying Nun“ aus Auckland hat uns speziell in den Achtzigern und Neunzigern Kiwi Pop à la The Chills, The Clean oder The Bats gebracht, sondern, viel spannender: Das Trio Wax Chatels selbst beschreibt sich laut Release Info als „Guitarless Guitar Music“. Interessant ist, dass mir das zunächst und ganz unpopmusikanalytisch gar nicht aufgefallen war: Keyboards, Bass, Drums und Gesang genügen. Amanda Cheng, Peter Ruddell und Tom Leggett sind in ihren mittleren Zwanzigern und klingen doch so erfahren, als seien sie so lange wie viele der hier genannten Referenzen unterwegs. Die Wax Chattels erinnern an die mehr dunklen, abgedrehten Vertreter*innen des Kiwi Pop, wie etwa Chris Knox‘ Tall Dwarfs, z.B. auf dem quirligen „In My Mouth“. Mehr davon, erfrischender Krach, der klar macht, dass es ernst wird und dass Wire, Suicide, Swell Maps, The Fall, Shellac und Jesus Lizard nicht vergessen werden – ob nun konkret auf diese bezogen oder nicht.
„Come On Die Young“, das vor über zwanzig Jahren erschienene zweite Album der Schotten, hörte und fühlte sich mit knapp 30, immer noch relativ frisch examiniert und im Praktikum bei „Rough Trade“ anders an als mit gut 50 als Hochschullehrer und Kolumnist. Der Glam des Slogans ist fast ganz verschwunden, die tolle, brachiale Musik bleibt. Ihr letztes Album aus 2017 Every Country’s Sun scheint eine ähnliche Entwicklung verklanglicht zu haben. Die Songs sind versöhnlicher, ja, sonniger geworden, nicht mehr so rau und dystopisch. Gleichwohl sind → Mogwai deswegen noch lange nicht Easy Going oder Fahrstuhlmuzak geworden. Wiederentdeckt habe ich die hauptamtlichen Instrumental-Postrocker über ihren phantastischen Soundtrack für die leider aufmerksamkeitsökonomisch etwas neben dem US-amerikanischen Remake untergehende französische Serie „The Returned“. Die Songs des letzten Mogwai-Albums sind mehr Songs denn die schillernden Fetzen auf dem Soundtrack. Die ekstatische Melancholie bleibt. Wenn auch Stücke wie das besungene „Party In The Dark“ fast schon etwas collegerockig sind.
Böser und näher an den frühen Mogwai sind die → Heads. aus Berlin und Melbourne. Deren erste beiden Alben waren mir schon sehr im positiven Sinne negativ aufgefallen, irgendwo zwischen Die Haut, The Birthday Party und all den wichtigen Noise Rock-Bands zumeist US-amerikanischer Prägung. Design und Titel des dritten Albums der Heads erinnert sicherlich nicht zufällig an The Jesus Lizard, die einst mit vierbuchstabigen Alben-Titeln glänzten. Der Bass auf „Weather Beaten“ bollert schon frech nah an David Sims, auch der Gesang von Ed Fraser klingt dem von David Yow nicht unähnlich. Das Instrumental „Rusty Sling“ klingt nach dem Big Black-Ableger Arsenal (das Jenseits von Steve Albini) mit echtem Schlagzeug. Alles erfrischend apokalyptisch. Mitgemischt haben u.a. Christoph Bartelt von Kadavar und Kristof Hahn von den Swans. Ich würde jeden der neuen Songs locker und gerne zwischen Messer, Rapeman, Jesus Lizard, Slint, frühen Nick Cave, Hugo Race und Kid Congo Powers auflegen. Die Heads zappeln und nerven, yes. Rums.
Imaginierte Innenhofinterkulturalität, scheinbare Gelangweiltheit und Dream Pop denn doch nochmal
Näher an Galaxie 500 und den bereits genannten übermächtigen Mazzy Star und ihrem ‚Vorläufer‘ Opal (noch viel näher als Geowulf, s.o.), höre mal etwa „Warmer“, als am Noise Rock der Achtziger bis Nuller Jahre sind die wunderbaren → Widowspeak aus Brooklyn. Von „The Dream“ an lassen einen diese irgendwie gleichzeitig verwaschenen und sehr präsenten Songs rausfließen aus dem Home Office in den Innenhof-Garten zu den Eichelhähern und amerikanischen, invasiven Eichhörnchen. Ja, selbst bei den Tieren des Innenhofs kann man politische Diskussionen beginnen, vor allem mit Idioten. Aber Widowspeak holen einen da weg, bevor man da war: „When I Tried“, „Right On“ sind tolle, tragisch-ertönende Songs von Molly Hamilton, Robert Earl Thomas, James Jano und Willy Muse, der nur scheinbare Gelangweiltheit prätentiös ausstellt. Expect The Best ist ein Album, dass ich wahrnahm, dann immerhin oben auf den Stapel der nicht zu vergessenden Musik legte, nun aber erst so richtig entdeckt habe. Dream Pop für Alpträume. Trost. Mal wieder. Und den imaginierten Innenhofler*innen sage ich dies: „Da es in einer Welt, die nicht mehr viel weiter globalisiert werden kann, kein Jenseits mehr gibt, von dem man träumen dürfte, kein noch so weit entferntes Ziel, zu dem man reisen könnte, bleibt nur noch das Zwischen, um neue Ressourcen zu entdecken: Wenn der Begriff des Inter-Kulturellen einen Sinn haben soll, kann er nur darin bestehen, dieses Zwischen, dieses Zwiegespräch als neue Dimension der Welt und der Kultur zur Entfaltung zu bringen.“ (Jullien 2017: 95-96) Und das auch noch: „Wenn jede Epoche ihre eigene Form des Widerstands kennt, so halten wir fest, worin er heute besteht: Wir müssen uns diesen beiden Bedrohungen – der Uniformisierung und dem Identitären – sorgfältig und beharrlich wiedersetzen. Und, gestützt auf die erfinderische Kraft des Abstands, den Weg zu einem intensiven Gemeinsamen eröffnen.“ (Jullien 2017: 96). Liebe Leute, am Kulturbegriff entwickelt sich alles. Hamilton sagt, sie singt über die Zukunft und Optimistisches.
Nikki Suddens Song „Jangle Town“ vom phantastischen 1986er-Album „Texas“ (mit u.a. Rowland S. Howard und Epic Soundtracks) hat mir einst klargemacht, was Jingle-Jangle in Bezug auf Popmusik meint: Lethargie, die aber nicht resignativ ist, Sonntagmorgenmüdigkeit gemischt mit leichter Glückseligkeit, ohne dem Frieden wirklich dauerhaft Glauben schenken zu können und mit einem Hauch von kalifornischer Küstenoffenheit à la Kacey Johansing. Ein bisschen so wie der momentan außergewöhnliche fast allnachmittägliche Spaziergang mit Freunden und ihrem Baby (mit Cordhose als Reminiszenz an mich, den ‚Corona-Paten‘) durchs Viertel. Die Sonne scheint, einfach mal durchatmen, aber bitte nicht zu tief wegen der Aerosole mit eventuellem Virus im Huckepack. → Anna Burch schlufft durch ihre Songs, dass es eine Freude ist. Die Detroiterin lässt schon mal fuzzy Gitarren mit Beach Boys-Feeling einhergehen. Und gibt mit schleichenden Songs wie „Jacket“ dem Wort ‚abgehangen‘ eine neue luzide Bedeutung.
Hibbeliger und durchaus in der mentalen Nachbarschaft zu den Television Personalities, The Fall oder auch den Wax Chattels bewegen sich → Pottery aus dem hübschen Montreal. Wobei sie mich hier ganz besonders an den schon genannten Jowe Head und dessen zahlreiche Projekte erinnern, was Verrücktheit, Selbstironie und popmusikalischen Witz bei gleichzeitigem Hang zum postpunkig Krautrockigen anbelangen. Manchmal wird sogar funky gestampft, wie auf „Hot Heater“, und dann lassen einem Pottery doch glattweg die alten Talking Heads-Platten wieder raussuchen. Die Produktion von Jonathan Schenke, der das auch schon bei Snail Mail und Parquet Courts getan hat, bot sich da an. So muss die Referenzhölle Pop (Thomas Meinecke) funktionieren. Klasse.
Obaro Ejimiwe aka → Ghostpoet erschafft nun schon zum zweiten Mal seltsame Stimmungen, die genauso in „Twin Peaks“, letzte neue Staffel, stattfinden könnten, wie Widowspeak dort auf einer Coffee Shop- oder Bar-Bühne am Highway performen. Ghostpoet hat sich wieder zusätzlich einen Haufen Gastsänger*innen eingeladen, um seine Produktionen zu verstimmlichen. Songs wie „Breaking Cover“ oder das ebenso luzid trostlose „Concrete Pony“ sind hörbar edler produziert, als dass sie aus den erwähnten Noise Rock- oder Dream Pop-Garagen kommen würden. Gleichwohl hilft nicht nur ein Blick in das Lyncheske Video von Thomas James zu „Concrete Pony“, dass hier auf angenehm gloomy-doomy Art und Weise etwas nicht stimmt.
Vor Jahren überraschte mich Joe Haege (u.a. 31 Knots, Tu Fawning) und seine Leipziger Begleiter auf dem sehr schönen, kleinen Münsteraner Open Air „Auf weiter Flur“. Während dieses mittlerweile leider eingestellte Festival draußen auf dem Feld vor der Stadt insgesamt schon schön, aber auch arg blumig-büchsenwerfend-hippiesk 2.0 war, verstörte der sympathische Herr Haege als → White Wine in seinem engen Anzug im Festzelt mit einer sehr schräg-freundlichen Performance und tollen kleinen Hits. Ganz toll. Wir lachten und holten den nächsten Drink. Wir waren kurz vorm Pogen, wobei der Mann im Fokus und auf der Bühne der intensivste Tänzer und mitten unter uns war. Dieses Ereignis geht erfreulicherweise auf den aus Samples, Minischlagzeug, Drum Machine, Saxophon und Obskuritäten zusammen gebauten und denn doch irgendwie indiemäßigen Punksongs nicht verloren. 14 teilweise kurze Stücke lassen schmunzeln, staunen, lachen und doch auch einfach so energisch losbrechen. Zu klagen, anzuklagen, zu beklagen, kann Spaß machen, das weiß nicht nur Rainald Goetz (2008): ,“Killer Brilliance“ und dann „Abundance“ und „I’d Run“. Und dann Joggen und „Irre“ (auch Goetz, hier 2015 [1986]) weiterlesen. Die Stadt, die die Klage schon im Namen trägt (Die Goldenen Zitronen). Fuck you.
‘Don’t cry – work’ heißt nunmehr ‘don’t work – cry’
Seht, es ist nicht wir, was da läuft, wir laufen nur als Illusion mit.
Reck 2018: 40
Das Leben erschöpft sich im permanenten Vor-Zeigen-Müssen.
Reck 2018: 41
Das mit dem Weitermachen in der Popmusik ist ja so eine Sache: Das kann einfach nur zeitlos toll und ohne neues Album sein, wie Palais Schaumburg, das kann schon sehr fulminant und dann etwas auslaufend geschehen, wie bei den Fehlfarben, und das kann hochnotpeinlich sein, wie bei so vielen anderen Vertreter*innen der ehemaligen progressiven Neuen deutschen Welle kultürlich mit kleinem „d“ (vgl. Jacke 2013). Was für eine tolle Zeit, ob aus dem Arbeiterviertel oder der Kunsthochschule, da wurde sich befreit vom Image des Spießigen, wenn auch schnell wieder plattgemacht von vielleicht für 13jährige Kleinstadteier wie mich hitverdächtigen Blöd-Acts wie Hubert Kah, Peter Schilling oder Nena (ja, die Achselhaare, ja, auch ich war verliebt, wenn auch nicht so wie in Lisa Germano, Polly Harvey oder Chan Marshall später, vor Kim Gordon hatte ich eher Angst, so cool fand ich die). Auf die Frauen der Neuen deutschen Welle kommen wir gleich zurück. → Der Plan war auch so ein Act, den man nie so ganz verstand, der aber ungemein faszinierend war. Erst viel später wurde die ganze Komplexität und der Witz dieses Kollektivs so richtig deutlich. Insofern ist auch hier ein Weitermachen wenig verwunderlich toll gelungen. Von Bubblegum-Pop über sehr viel tiefstem Dub und den immer noch funktionierenden Mini-Dadaismen haben Moritz R, Kurt Dahlke und Frank Fenstermacher offenbar viel zu sagen, singen, komponieren im Sinne von basteln. Unkapitulierbar ist vom Titel über das Coverbild bis hin zu den 15 Song-Texten einfach im Hier und Jetzt und Nirgendwo. Anti-Hits wie „Stille hören“ schreien nach lautem Abspielen und zeitlupenhaftem Tanz in Corona-Isolation bis hin zum Easy-Listening-Chanson „Flohmarkt der Gefühle“. Hätten Air auch nicht besser hinbekommen. Und niemals so obskur. Kennt noch jemand Air? Der Plan. Wunderbar. Bausteinhaft groß.
Von den wenigen weiblichen Acts der neuen Deutschen Welle mit kleinem „d“ sind die Hannoveranerinnen Hans-A-Plast, die Berlinerinnen Mania D/Malaria und die Düsseldorferinnen → Östro 430 nicht nur die punkigsten, sondern auch die bekanntesten gewesen. Östro 430 treten wieder auf, zunächst gibt es vorweg eine große bunte feine Sammlung ihrer Musik aus den Jahren 1981-1983 namens Keine Krise kann mich schocken, alles wurde hier kompiliert, was seinerzeit im Studio aufgenommen wurde: 24 Songs, darunter schon seinerzeit gerne gehörte ‚Club-Hits‘ wie „Sexueller Notstand“, „Dallas“, „Sei lieb“, „Vampir“ (mein größter Hit der Band) oder „Meerschweinchen“. Eigentlich sind das alles Hits, das ist ja unglaublich.
Zwischen alter Neuer deutscher Welle und neuer neuer Neuer deutscher Welle à la Candelilla, Die Heiterkeit, Die Nerven, Karies, Messer, Friends of Gas gab es wichtige Bands wie Surrogat, → Mutter oder Wuhling, die manchmal wahrscheinlich etwas zu abseitig waren, um wirklich in den Mainstream des Indies aufzusteigen. Wobei eher noch Max Müllers Mutter als Anne Rolfs Wuhling oder später vor allem AUF sich eingeschrieben haben in den Anti-Kanon. Mutters Unberechenbarkeit bleibt legendär. Meint man gerade mal auf dem richtigen Pfad zu sein, dreht und wendet sich diese Monster-Band gleich wieder. Mutter sind hier nah am bereits erwähnten Noise Rock der letzten Jahrzehnte, alleine der Titelsong „Der Traum vom Anderssein“ sägt einen vom Schreibtisch weg, während draußen die Krankenwagen fahren. Nach Mutter ist alles anders. Mal wieder (zu Mutter siehe auch Teil 3 dieser Kolumne). Von wegen Traum. → AUF sind Anne Rolfs und Mathias Brendel, der schon Peaches am Schlagzeug rhythmisierte, und wer hier in die Popmusikgeschichten tiefer einsteigt, wird eine Menge Verbindungen zwischen all den hier genannten Genres finden. AUF haben mich gepackt, das ist ‚different‘, das ist viele Stile und Ideen in einem alternativen Gewand, das vielleicht noch am ehesten im Umfeld von Indie, Noise und Post wirkt, aber eben dann mit deutschen Texten. Ich möchte mich entschuldigen, diese Musik bisher überhört zu haben. „Mag“ mögen. Immer mehr. „In der heutigen Zeit und angesichts der Fetischisierung von Erfolg würde Erfolglosigkeit eine moralisch höherwertige Tugend und Widerstand gegen den Fetisch von Erfolg und Akkumulation zu einer Bürgerpflicht ersten Ranges werden. Erfolgsverweigerung aber macht sich nicht von alleine, sie muss geformt, erstritten, ausgestaltet werden. Und dies keineswegs – trügerisch, tarnend, verlogen – als neue Form vorzeigbaren Erfolgs.“ (Reck 2018: 43)
→“Die Liebe frisst das Leben“ ist schon eine Art Doku-Hommage des Regisseurs Oliver Schwabe (u.a. Fraktus, Asi mit Niwoh, Zarte Parasiten sowie zahlreiche sehenswerte Popmusik-Dokumentationen) an Tobias Gruben, den 1996 überraschend verstorbenen Denker und Macher hinter der Band Die Erde. Der im positiven Sinne erschütternde Soundtrack ist dementsprechend zusammengestellt: Zwei Varianten der Band Die Erde, Grubens weitere Projekte Sol und Cyan Revue drei bisher unveröffentlichte Songs von Gruben und dann klangliche Huldigungen von Isolation Berlin, Timm Völker, Tom Schilling, Tellavision, Paul Pötsch und Messer. Es fehlt ein wenig das seltsam-dancige Projekt Heroina mit Matthias Arfmann und Günther Janssen. Da ich Ollie Schwabe schon länger ein Stückweit begleite, einst nannte mir mein Freud Nikki Sudden den Film „Egoshooter“ von Ollie, weil Nikki dort eine kleine Rolle spielte, das war Ollies erster Spielfilm mit Tom Schilling. Ollie, der auch als langjähriger Lehrbeauftragter immer wieder tolle Projekte bei uns im Studiengang Populäre Musik und Medien (dessen Master-Variante übrigens Robert Henschel studierte) initiiert, lebt hier in Film und Soundtrack seine Vorliebe zu im weiten Sinn postpunkigen Acts aus. Die Erde gingen mir zwischen Palais Schaumburg, Einstürzende Neubauten, Flowerpornoes und Blumfeld verschütt. Nun haben Ollie Schwabe und all die Musiker*innen (schon sehr jungslastig das Ganze hier, da nehme ich mich nicht aus) Tobias Gruben in Sound und Vision ausgegraben und mit neuem Glanz versehen: Zwischen Fan und möglichst neutralem Beobachter wird hier auf Grubens Schaffen geblickt, ich wollte kommende Woche in die Preview hier in Münsters „Cinema“ gehen, Corona lässt uns warten. Es gibt kein geregeltes Leben. Doch nochmal die Milch rausholen.
Und dann gibt es da noch dieses ständig anwachsende Brassbandirgendwas-Ü40dings aus Hangover, mittlerweile weit über 20 Bläser, Perkussionisten und einen hannoveranerisch-U.S-amerikanischen Kunstlehrer-Sänger und Performer, bei dem wir nie so ganz wissen, ob er auf Deutsch, Englisch, Russisch, Hindi oder in einer erfunden Sprache singtschreitjaultspricht: → Die Königliche Braut spielen sich von Jahr zu Jahr um ihre blaugoldenen Kragen, haben eine beachtliche Fan-Schar vereint und doch auch Schalke im Nacken. Scheiß Geschenke ist selbst produziert und veröffentlicht und ein blecherner Blumenstrauß voller (Selbst-)Erkenntnisse und – nun ja – reflektierter Mitsaufsongs. Wer sonst traut sich schon, über Arschprobleme von Männern über 40, über „Scheiss Geschenke“, das „Emseland“ oder das „Discotier“ (sozusagen die Singleauskopplung, wenn es sie denn gegeben hätte) zu singen?
Nichtdichtung im guten Sinn ist einfach Abschrift des jeweils Gegebenen, was keine Vorgabe an Einfachheit beinhaltet, aber eine an Objektivität. Ob ein Text in diesem Sinn von Objektivität gesteuert zu sein sich bemüht, egal ob im abstrakten oder konkreten Raum, kann man an seinem Sound sofort hören, auch wenn es manchmal nicht so leicht nachzuweisen wie zu erkennen ist.
Goetz 2008: 175
Indietronics können singen bis ins Rauschen – now on, now on, now on never
Der Journalist Elias Kreuzmair beschrieb in der Taz Valerie Trebeljahr (bzw. ihren Gesang) als ein „Mischwesen aus Geist und Roboter“ (2017: 15) und das fünfte → Lali Puna-Album Two Windows als herausragend. Für mich waren sie fast noch deutlicher als ihre Weilheimer Cousins von The Notwist das, was der Journalist Jan-Ole Jöhnk einst „Indietronics“ taufte. Auch wenn der Begriff kaum noch benutzt wird, musste ich bei Songtracks wie dem Titelstück oder „Deep Dream“ wieder daran denken. Haltung mischt sich mit Sound und auch den Erzählungen, die sich hier viel um Bewegung (Nachtschichtbus), Entwicklung, Transformnation, Emanzipation zu drehen scheinen, wenn meine Eindrücke nicht täuschen. Spätestens bei „The Frame“, auf dem Dntel gastiert (so wie es auf dem Album auch noch Mary Lattimore, Radioactive Man und MimiCof tun), kommen die anderen großen Indietroniker um die kanadischen The Postal Service wieder ins popmusikkulturelle Gedächtnis. Bescheidene Größe und angenehm pumpender Indie-Dance, das hier.
→ Spirit Fest auf demselben Label, welches eben für Indietronics so bekannt und beliebt wurde, pumpen weniger, sondern rauschen. Also, nicht das elektronische, sondern eher das aus den Blättern und dem Wind erzeugte. Diese kleine große Supergroup dieses Genres aus UK, Japan, Griechenland, Deutschland usw. mit Mitgliedern von Tenniscoats (unvergessen für mich ist die Kooperation des japanischen Duos mit den schottisch-britischen C86- und Proto-Twee-Pop-Pionieren The Pastels), The Notwist, Joasihno, Aloa Input und Jam Money ist dann fast näher an Widowspeak (s.o.) als an Lali Puna. Verglichen damit wirkt das hier bei Spirit Fest alles eher Avant-Pop-artig, zurückgezogener, zarter, ohne gleich LoFi zu sein, Songs wie „Deja Vu“ schleichen sich in den Samstagabend und setzen sich auf Deine Schultern, verweilen, klingen wie The Notwist auf Opium aus einem mit Samt verzierten Schuhkarton. Einem wie denjenigen, die man ein-, zweimal im Jahr aus der hintersten verstaubten Zimmerecke holt, um alte Liebesbriefe zu lesen und melancholisch zu sein. Bis man selbst wieder schmunzelt, höre „Nambei“. Ganz toll. Und dann, mit dem Zweitling Anohito aus 2018 und dem aktuellen Mirage Mirage aus 2020 wird alles noch fluffiger, kollektiver, zusammenhängender und schöner. Wie die Blumenbeete aus Buchstaben vor dem farbenfrohen Kurhotel, aufgenommen in Home Offices in Tokyo und vor allem München. Ich bin fast sprachlos.
Verquerer und doch in direkter Nachbarschaft ist ein Album entstanden, was laut eigener Auskunft nach den Spielregeln des Pop hätte gar nicht entstehen dürfen. ‚Ausproduziert‘, so wird das hier genannt, haben das Ganze die auch bei Spirit Fest beteiligten Markus Acher und Cico Beck. Wenn ich heute den Album-Titel Post Europe lese, werde ich zunächst melancholisch: Gibt es eine Zeit nach Europa? Und dann denke ich aber, nein, Moment, es ist wie bei der Postmoderne, keine komplett neue Zeit, sondern eine faszinierende neue Phase. → 1115 ist ein außerordentlich komplexes und – Wortwitz – vertracktes Projekt inklusive Cover-Entwurfsplänen als Booklet der CD (LP wäre sicherlich adäquater) und Infosheet mit einer Menge Zitaten und Fußnoten mit der Anmerkung, dass Fußnoten, Töne seien, die beim Tanzen fielen. Wow. Stimmt schon, 1115 hört man die Rezeption von Sun Ra, Juan Atkins, Moritz von Oswald und Arca an, nicht so verstohlen wie Spirit Fest, nicht so strahlend wie Lali Puna, sondern politisiert-minimaler. Also, ich falle in die Tracks und vergesse die Konzepte nicht gänzlich, Doppelflow sozusagen. Ich bin drin.
→ Mark Pritchard betont laut Info der Plattenfirma bzw. Promotion Agentur, dass The Four Worlds nach seinem (bis heute) letzten Album „Under The Sun“ aus 2016 kein neues Album, sondern eine Kollektion von acht neuen Tracks sei. Mit The Space Lady aka Susan Dietrich Schneider, Gregory Whitehead und dem wieder für Artwork und Visuals zuständigen Jonathan Zawada holte sich der britische Musikproduzent, DJ und Labelmacher eine Menge Unterstützung an Bord. Das Genießen von „The Four Worlds“ braucht das eigentlich alles gar nicht. Denn die Tracks laufen los, sind nicht so technoid und überbaufordernd wie eben genannte, ebenso nicht so indietronisch wie die davor. Allesamt wunderbare Musik. Pritchards Tracks passen da bestens: Es ist Ostern, die Sonne scheint, der Virus kreist, traue dem Frieden nicht. Pritchard vermengt hier Sounds des frühen Synthie Pops mit eben „Warp“-Ästhetiken und kreiert nur scheinbar übersichtliche Landschaften.
Der australische Tausendsassa → Lawrence English, der neben seinen vielen musikalischen Projekten auch in den Sound Studies forscht, als Journalist und Labelbetreiber fungiert, gab vor Jahren auf dem wunderbaren Festival „Madeiradig“ einen Workshop zu Field Recordings und zum Hören, bei dem ich die Freude hatte, mit Studierenden teilnehmen zu können. Daraus entstanden ist u.a. ein Gespräch mit Lawrence. Ich hatte das große Glück, mit zwei tollen Master-Seminaren das „Madeiradig“ besuchen und von den Studierenden, begleiten, kommentieren und dokumentieren zu können. Das Besondere an Lawrence war für mich neben seiner Freundlichkeit und Reflektiertheit, dass er abends hinter der Konsole dann doch erfreulich kein Erbarmen kannte und mir klar wurde, warum er tagsüber eine Jute-Tasche mit dem Emblem der Einstürzenden Neubauten umhängen hatte. Cruel Optimism klingt wie sein damaliger Auftritt: Ganz viel Trockeneis mischt sich mit Krach, Geräuschen, Field Recordings und entwickelt eine geradezu verzweigt-feine eigene Schönheit. Das ideale Set zwischen Pritchard und dem auch schon auf „Madeiradig“ vertretenen → Ben Frost (mein wohl lautestes Konzert vor Swans, The Jesus & Mary Chain und Spacemen 3). Lawrence selbst sagt Ende 2016 im das Promo begleitenden Info: „I leave it to you then, to listen as you can. This record is one of protest against the immediate threat of adhorrent possible futures. It’s an object of projection, from me to you and onward from there.“ Schillernd, glänzend lullt Dich Lawrence mit seinen Soundwolken ein und lässt mich jedenfalls nicht mehr los. Bis der Frost kommt. Und in die Wolken stampft. Mit dem Album The Centre Cannot Hold und den E.P.s All That You Love Will Be Eviscerated (anschließend) und Threshold of Faith (vorab). Längst und nicht nur wegen seines Soundtracks für u.a. „Fortitude“ und „Dark“ ist der Wahl-Isländer zum Superstar des Ambient Noise geworden. Alva Noto und Steve Albini haben ihm hier auch gleich ihre Ehre erwiesen und mitgearbeitet bzw. geremixt. Zentnerschwer wiegt das. Und hey, Lawrence English ist alles andere als leicht, verglichen hiermit aber eine Feder – und das soll kein Nachteil sein. Frost wiegt schwer auf den Schultern an einem Sonnentag, Beatmungsgerätgeräusche inklusive. Gewaltig. Puh.
Nachdem der Wald niedergewalzt wurde, richtet er sich im Morgengrauen wieder auf, der visuelle Künstler und Filmmusiker → Hannu Karjalainen nimmt einen gleich mit dem funkelnden „Angel“ oder dem pianolastigen „The Emigrant“ an der Hand. Ohne mit Frost zu brechen oder besserwisserisch English zuzublinzeln. Das passt hier alles schon nahezu perfekt in der Komposition der Schichten und Phasen. Karjalainen hat u.A. schon einen Remix für Dakota Suite produziert und lässt auf A Handful of Dust Is A Desert die Größenverhältnisse lächeln, tanzen kann ich es nicht nennen, dafür sind denn doch zu viele Sprengsel aus kompaktem (Pop) Ambient, Drone und Experimental zu identifizieren.
→ Anjou schließt an, wieder schwebender, raumschiffartiger, mehr Lawrence English als Karjalainen. Mark Nelson und Robert Donne zeichnen gemeinsam für Labradford verantwortlich, solo dann für Pan American (Nelson) bzw. Aix Em Klemm und Cristal (Donne). Für mich waren diese Acts, vor allem Labradford und Pan American die Brücke aus dem Chicago-Postrock-Land rüber in die Maria am Ostbahnhof und den Berliner Dub. Epithymía kommt aus dem Griechischen und meint so etwas wie Wunsch, Begehren oder Verlangen. Anjou sind über vier lange und zwei kurze Tracks ganz nah an Englishs Amöben, gleichwohl sanfter, ohne soviel Trockeneis, mehr mit Morgendunst behaftet.
Das alles hier sind großartige Sounds für Tage, an denen man nicht nur nicht weiß, warum man traurig-melancholisch ist, sondern sich noch nicht mal dieser Tatsache sicher ist, an denen nur die Selbsterkenntnis der Einsamkeit zählt. Immerhin.
Amöben sagen „Hallo“ – und be-rühren zutiefst
→ Sonaes Stück „Dream Sequence“ (mit Gregor Schwellenbach) ist die geniale Überleitung, Ergänzung, nein, besser Krönung all der gerade beschriebenen Klangamöben. Dieses Stück habe ich auflegend ausprobiert, obwohl ich wusste, dass es die Bar-Boxen nicht hergeben würden. I Started Wearing Black wird seinen Grund haben. So nahe klingt hier auch Mark Fishers Melancholie. Dann wieder mehr Mechanik. Nach vorne. Hier passiert so vieles auf Seitenstraßen und -wegen neben dem Beat, dass eine Entdeckung die nächste jagt (zu Sonae siehe auch Teil 3 dieser Kolumne). Dann nochmal „Dream Sequence“.
Die gebürtige Kolumbianerin und dann Barcelonierin und Berlinerin → Lucrecia Dalt begegnete mir ebenfalls auf dem schon erwähnten „Madeiradig“-Festival mit ihrem nicht nur für mich be- und verzaubernden After Show-Konzert an den Klippen. Tuxedomoon, Wire, Minimal Compact (die sie im anschließenden Gespräch nicht wirklich zu kennen behauptete) und doch ganz eigenen Songs, Miniaturen mit viel Bass, Gitarre, Geräten, Electronics und Gesang haben mich komplett hypnotisiert. Einem Bekannten und mir waren augenzwinkernde Kommentare egal, wir haben Lucrecias eh nicht mehr so sehr gefüllten Merch-Koffer leer gekauft. Ein Glück. Dalt ist danach immer abstrakter geworden, weg aus dem eigentlichen Songwriting mit ihrem spanischen oder englischen Gesang hin zu experimentelleren Flächen. So auch auf Anticlines. 14, ja was eigentlich, mehr als Skizzen und dennoch nicht wirklich Songs. So tastet sie sich voran. Sie wirft Sound, Poetry, europäische Elektronik, lateinamerikanische Rhythmen und letztlich auch ihre Geologinnen-Vorkenntnis in eine Waagschale namens „Anticlines“. Spoken Word dazu. Darin. Spacig-architektonische, ja vielleicht sogar irgendwie sound-geologische Erkundungen. Wieder und weiter aufsaugend.
Und nochmals „Madeiradig“ hat auch dieses Kennenlernen verursacht: Liz Harris performte dort schon als → Grouper und dann im letzten Dezember als ebenso begeisternde Nivhek. Als Grouper gab sie dort das leiseste Konzert vor der brüllenden Pharmakon, verschwand hinter dem Desk und ihrer Gitarre und war doch unglaublich da in einem (zu Grouper siehe auch Teil 3 dieser Kolumne, zu Helen Teil 4 dieser Kolumne). Grid of Points wirkt wie die Alben davor und auch wie Harris‘ andere Projekte z.B. als Nivhek oder Helen: Sofortige totale Rührung, Be-Rührung, total im Sinne von ganzheitlich, systemisch, umfassend. Wenige Acts verursachen das derart tiefgehend, Bersarin Quartett vielleicht noch. Nein, mit Sicherheit. Wieso habe ich Liz Harris noch nicht angesprochen, wenn sie doch schon ständig in der Reihe neben, vor oder hinter mir saß? Ich glaube, ich wollte den Mythos ihrer entrückten Musik nicht durch einen Reality Check angreifen. Wobei. „Parking Lot“ oder „Birthday Song“ sind die traurigsten hingehauchten Pianoballaden, die ich seit Epic Soundtracks oder Damien Jurado (siehe unten) genossen habe. Wobei Grouper immer so klingen, als kämen die Sounds mit einem kraftvollem letzten Aufbäumen von ganz weit hinten aus der Halle, eventuell sogar aus einem Nebenraum. Wenn es nicht so abgegriffen, verniedlichend und irgendwie comichaft klingen würde, ach was, ich schreibe es jetzt einfach: Schluchz. Kein Scherz. Bitte nicht scherzen jetzt.
→ The Sea And Cake aus Chicago waren nicht nur wegen ihrer ganzen kleinen Mitglieder-Stars oder Star-Mitglieder des Postrocks eine Supergruppe. Ihr Album „Nassau“ (1995) war für mich sicherlich genauso wichtig wie Tortoise‘ gleichnamiges Debüt aus 1994, überschneiden taten sich beide Bands sowieso schon alleine personell. Dann legte Sam Prekop auf seinem Solo-Album von 1999 mit „Showrooms“ einen der fluffigsten Songs der Popgeschichte nach. Dann lief er mir im Münsteraner „Gleis 22“ total unsympathisch über den Weg. Seltsam, wie drei Sekunden alles verändern können. Naja, nicht ganz. Die Musik bleibt. Und wurde solo und in der Band auch mal sehr experimentierend. Any Day ist das nicht, zeigt The Sea And Cake als Trio (Prekop, John McEntire, Archer Prewitt) und ist richtig gut. „Cover The Mountains“, „I Should Care“ oder mein hiesiger Lieblingssong „Circle“ haben sie wieder, diese eingängige, catchy und doch auch postrockige Leichtigkeit mit einem Schwung Dauerreflexion. Pop. Prekop hatte sicherlich einen schlechten Tag. Ich vielleicht auch. „Any Day“ begeistert. Voll und ganz.
Anders und doch auch nicht ganz weit entfernt von Prekop und The Sea And Cake sind → Damien Jurados Songs, mal reduziert, sehr persönlich (auch erstmals von ihm selbst produziert) und balladesk wie auf dem wundervollen The Horizon Just Laughed aus 2018, mal eher folkrockiger und als Band wie auf dem jüngst erschienen What’s New, Tomboy?. Ersteres ist schlichtweg ein Inselalbum. Nothing more, nothing less. Direkt zwischen Nick Drake, Epic Soundtracks, Bill Callahan,José González, und Laura Nyro steht dieses indie-soulige Meisterwerk schon länger im Heavy Rotation-Fach. Zweiteres ist anders und doch auch ganz Jurado, keinesfalls beunruhigend, getröstet wird hier öfters auf einem etwas lauterem Weg wie auf „Birds Tricked Into The Trees“. Schon beim darauffolgenden „Ochoa“ wird es wieder introvertierter. Im Grunde könnte dies auch ein Doppelalbum sein.
Wer aufs Detail achtet, kann hier eine Playlist meiner Verweise auf Insel-Songs erstellen: Ganz oben darauf oder mitten drunter muss sich „Richard“ von → Nadia Reids 2017er-Album Preservation finden lassen. Was für ein wundervolles Lied, dass für mich nachträglich meine Neuseeland-Reise nochmals aufwertet, falls das überhaupt geht. Reid kommt aus Port Chalmers in der Nähe unserer vorletzten Station Dunedin, bevor wir ins traurig-tapfere, durchgeschüttelte Christchurch zum Abflug gelangten. Ich müsste sie dazu befragen, doch für mich ist Reids leichtes und gleichzeitig melancholisches Songwriting nah am ‚Sound of Dunedin‘ (The Chills, The Bats, The Clean), dem dort auch gleich museal ein Denkmal gesetzt wird. Im Museum eben. Nebenan in „Chick’s Hotel“ widmete uns Robert Scott einen Song und sahen wir Plakate von einem ‚Wohnzimmerkonzert‘ von Shellac einige Wochen zuvor. War Frau Reid an jenem Abend wohl auch dort? Nun jedenfalls geht Reid wieder Out of My Province mit ihrem dritten Album. Drumbox, Gitarre, Seele überall, und dann singt Reid über „All of My Love“ oder „High And Lonely“. Seufz. Zu „Oh Canada“ und „Other Side of the Wheel“ werde ich eines Tages wieder an Dunedin vorbeifahren und bei Robert Scott anklingeln, der dann wieder zu meinem Stöhnen über das stürmische Unwetter und die Sorge um den unter seinem Vorgartenbaum geparkten Leihwagen sagen wird: „It’s windy“. Ich schrieb eben schon mal übers Weinen. Reids Songs und sicherlich beteiligt auch Matthew E. Whites Ko-Produktion tun das auch. Erleichterndes Weinen. Ich möchte da wieder hin. Nach Neuseeland. In eine Nähe, ein Gewand, eine Rüstung, eine Liebe. Mit guter Popmusik und so auch Nadia Reid immer um uns. Soul. Bläser. Diese Stimme. Wie und was sie singt und sagt. Tränen.
Trost – Tränen – Trauer – Trotz: Far, far, far, far, far…
Diese oder besser gesagt ältere aber ähnlich schmeckende Tränen vergoss ich einst zu der Überballade „Broken Heart“ von Jason Pierces → Spiritualized auf deren Jahrhundertalbum „Ladies And Gentlemen We Are Floating in Space“ von 1997, dem wohl schönsten Selbstmitleidsong neben allen Songs auf „Robespierre’s Velvet Basement“ der schon erwähnten Jacobites. Anyway, Der Ex-Spaceman Jason Pierce, neben dem unentwegten Sonic Boom aka Peter Kember, der übrigens im Juni sein erstes echtes Soloalbum nach 30 (!) Jahren veröffentlichen wird, einst als Stütze der Raumfahrenden, legt mit seiner Band Spiritualized nach. Deren Album And Nothing Hurt aus 2018 zeigt Pierce souverän und überblickend wie schon lange nicht. Krankenhausaufenthalte und Krisen hatten ihn schon arg betroffen, das alles wird hier verarbeitet. Doch Jason hat, selbst wenn mehr am Laptop denn je, sein orchestral-bombastisches Moment wiederentdeckt, höre etwa den Opener „A Perfect Miracle“. Für mich haben Country, Folk, Soul und Blues mehr Einfluss denn je. Als öffneten sich Spiritualized ihren Wurzeln und feierten sie.
Womit wir nochmal einen Schritt weiter aus Neuseeland und Spaceland heraus schreiten, Tränen wegwischen, Ärsche sich bewegen lassen. Der trotzige Tanz nach der Trauer, war das nicht früher auch schon so? → Jackie Lynn erinnert mit ihrem neuen Album Jacqueline an Disco, Synthie Pop und manchmal auch Computerspiel-Klänge und Electronica einer längst vergangenen Pop-Zeit. Jackie Lynn aka Haley Fohr aka Circuit des Yeux lebt in diesem Alter Ego die Tanzflächensucht aus. Und das macht echt Spaß. Für Fohrs sonstige Verhältnisse beinahe rockig haut uns Lynn Songs um die überraschten Ohren, die ja im Namen auch auf E.L.O.s Jeff Lynn verweisen könnte, wenn man die Gitarrenriffs und klaren Songstrukturen auf „Jacqueline“ bedenkt.
Apropos Hauen: Selten wird man so sanft und lächelnd vertrümmt wie bei den phantastischen Irgendwas-Hip-Hoppern der → Shabazz Palaces, deren neues Album The Don of Diamond Dreams ein kleines, Ideen versprühendes Meisterwerk geworden ist. Ishmael Butler, Produzent und Sänger hinter den Palästen, bezieht sich auf Sun Ra, George Clinton und Alice Coltrane und hat mit Flying Lotus, Battles, Animal Collective gearbeitet, wen wundert es. Nach Yves Tumor, Chilly Gonzales und Amnesia Scanner passen die Shabazz Palaces bestens, in ihrem Witz (überall robotische Vocoder und Auto-Tunes), ihrer Buntheit und ihrem Groove reißen sie mit. Und wie. Groß. Gibt es großes Mitreißen?
Hilfe, → Dirtmusics Mischung ist ähnlich krude und mitreißend, aber irgendwie dann doch weltmusikalisch-ernsthafter, und das ist hier weder positiv noch negativ gemeint. Chris Brokaw ist schon länger nicht mehr dabei, Chris Eckman (u.a. Walkabouts) und Hugo Race (u.a. True Spirit) die Masterminds hinter Dirtmusic (zu Hugo Race siehe auch Teil 5 dieser Kolumne). Die beiden reisen weiter um die Welt und durch die Popmusikwelten und heuern an. In diesem Fall bildet Murat Ertel von Baba Zula aus Istanbul das Zentrum des neuen fünften Albums Bu Bir Ruya. Race erzählte mir vor einiger Zeit, dass das Nomadentum ihn und Eckman nach der fruchtbaren Kooperation für drei Alben mit Tamikrest aus Mali dieses Mal dann nach Istanbul verschlagen habe. Dort entstanden psychedelische, hypnotische und sehr filmmusikartige lange Stücke. Das neu formierte Trio setzt sich nicht nur über ihre jeweiligen Verständnisse von Swamp Blues mit Grenzen und mauern auseinander, selbst fließend unterwegs sein könnend, immer kritisch auf neue Stacheldrähte und Nationalismen blickend, denen sie als transkulturelles Projekt entgegenmusizieren. Als seien es Race nicht genügend Produktionen mit Fatalists, True Spirit, Dirtmusic, Michelangelo Russo und solo, hat er gleich auch noch eine weitere Zusammenarbeit unterstützt: Mit der belgischen Geigerin → Catherine Graindorge (Monsoon, Nox, Détroit, John Parish, Andrea Schroeder) hat er 2017 als → LDO – Long Distance Operators – teilweise Tracks produziert, die sehr experimentell und weit draußen ambient erklingen. Das Duo erinnert eher an flächige Momente der Dirty Three oder Mailorder Only-Alben von Race als an den sumpfigen Blues seiner Bands. Wobei, Dinger wie „Brother Sister“ könnten schon auch drogig-verschrobene Filme oder Auftritte zieren. David Lynch winkt durch das vorhangverhängte Fenster im Motel. Dabei ergänzen sich Gitarren, Electronics, Races tiefe Erzählstimme sowie Graindorges Violine und prägnante Stimme adäquat. So werden diese Tracks zu Trips. „It all comes back to love“, flüstert-raunt Race auf „Immortality“. Nun denn. Zum majestätisch angekränkelten „On Ice“ gehe ich dann mal wieder Corona-Joggen.
Von Race als Gründungsmitglied von Nick Caves Bad Seeds und Berlino-Australier der ersten Generation zu Lydia Lunch und Rowland S. Howard ist der popmusikkulturelle Weg nicht weit, sondern ganz nah. Bereits vor einigen Jahren hatte der britische Gitarrist verloren gegangene Songs des großen Jeffrey Lee Pierce (The Gun Club) ausgegraben und neu interpretieren lassen, so auch von von alten Wegbegleitenden wie u.a. Nick Cave und Lydia Lunch. Daraus entstand darüber hinaus 2014 das erste Lunch & Grove-Album mit Coverversionen (zu → Lydia Lunch & Cypress Grove siehe auch Teil 2 dieser Kolumne). Neben Bearbeitungen von Songs von Jon Bon Jovi (wirklich), Jim Morrison oder Tom Petty findet sich hier auch ein zusammen geschriebenes und gesungenes sehr tolles Stück mit James Johnston (Gallon Drunk, Bad Seeds, PJ Harvey): „Won’t Leave You Alone“. Reiten wir nicht irgendwie alle durch irgendeinen rauen Western, ob nun in „Westworld“ oder dem realen Leben? Alles gipfelt in David Lowerys „Low“ (Cracker). Lydia Lunch bleibt die Grande Dame des feministischen No Wave, ohne das lange erklären zu müssen, sondern gerne mal mitten aufs Maul. Das streicht Cypress Grove pointiert heraus her.
→ Rowland S. Howard war nicht nur entscheidender Gitarrist der Young Charlatans, der Boys Next Door, der Birthday Party und der frühen Variante von Crime & The City Solution, sondern auch in unzähligen Duos wie etwa mit Nikki Sudden oder eben als Shotgun Wedding mit Lydia Lunch verstrickt. Seine eigentliche eigene Band These Immortal Souls und seine beiden Soloalben sollten nun anhand der aktuellen Rereleases von Teenage Snuff Film aus dem Jahr 1998 und Pop Crimes 2009 quasi zu Rowlands Tod gewürdigt werden. Ich mache es mir hier mal einfach, weil ich diese und Howards Gesamtwerk an anderer, prominenter Stelle bereits würdigen durfte (siehe aber auch der Nachruf im Guardian).
Antitum – so far and from now on
Um nun nicht mit einer Verlinkung zu Besprechungen gleichwohl sehr und gar nicht im Badiou’schen Sinne ungeheuerlich wichtiger Alben von Rowland S. Howard zu enden, sondern vor dem Outro noch etwas ganz Direktes mitzugeben, das aus meiner Perspektive alle hier verhandelten Musiker*innen bzw. ihre Songs, Tracks, Dinger ein ganzes Stückweit verkörpern bzw. repräsentieren – und sei es nur in meiner nicht anarchistisch-willkürlichen Lesart: produktiver Protest, konstruktives Anderssein, ätzend-aufbauende Kritik, visionäres Nichteinverstandensein und konkrete Utopie. Diese Musiken scheinen somit auf der einzig möglichen richtigen Seite zu stehen, um den zukünftigen Herausforderungen für Verhältnismäßigkeit, Klima, Natur und Gesellschaft und gegen Verhältnislosigkeit, Umweltzerstörung, Raubbau und Populismus gerecht begegnen zu können, so schwulstig das hier klingt. Es ist unsere Aufgabe als Musiker*innen, Journalist*innen, Wissenschaftler*innen, Denker*innen, Kreative, uns einzumischen, mitzugestalten, gegen „[…] eine latente Mob-Mentalität im virtuellen Wildwest-Raum […]“ (Heiser 2018: 105) zu wirken und „[…] die Polarisierung in unserer gegenwärtigen Gesellschaft zu untersuchen – also den Widerstreit zwischen ‚reaktionären‘ und ‚emanzipatorischen‘ Positionen, zwischen Vergröberung und Verfeinerung, zwischen der immer drastischer formulierten Beschwörung identitärer Weltbilder und dem immer offensiver vorgetragenen Einspruch gegen die kulturellen und sozialen Traditionen, aus denen diese Weltbilder entspringen.“ (Balzer 2019: 12) Auch in meiner Kolumne bemühe ich mich (wenig prekär wie so viele Freischaffende, dazu mehr an anderer Stelle) um eine zitat- und verweisreiche Kritik, die freilich zumeist eher Musik hervorheben und würdigen möchte, die mir gefällt und eher nicht das langweilige oder sogar schlimme Zeug in Grund und Boden zu schreiben versucht. Aber wir sind ja weiterhin am Ausprobieren. Nochmal mit den Worten von Jens Balzer: „Die Frage bleibt, warum diese Art der musikalischen Hassrede in den letzten Jahren so wenig kritisiert worden ist und wie man das ändert, ohne den Pop zugleich auf den Ausdruck rein politisch abgeleiteter Moralimperative zu verpflichten und dabei seinen ästhetischen Eigenwert zu verfehlen – wie man also wieder zu einer Art der Kritik zu gelangen vermag, die den Wert der Grenzüberschreitung erkennt und feiert, aber zugleich jene Grenzen benennt, an denen sich die Überschreitung in Diskriminierung und Hass verwandelt.“ (Balzer 2019: 36)
Lassen wir den von Robert Misik (2019: 83) beschriebenen neuen Snobismus im Sinne einer Ignoranz gegenüber anderen kulturellen Praktiken nicht zu. Überlassen wir im Sinne Larry Grossbergs (2012) die Kulturschutzgebiete des Pop und ihre Reflexion und somit eigentlich auch alle Kulturen nicht nur sich selbst, der Politik oder dem Mainstream der Wirtschaftswissenschaften. Die ausgeruhte und finanzierte Konstitution und Reflexion von Kulturanalysen und Analysekulturen ist eine prädestinierte gesellschaftliche Position. Noch wichtiger: Es gibt einen Bereich zwischen ‚zu Tode betrübt‘ und ‚immer lustig und vergnügt‘ (vgl. Jacke 2017, Theweleit 2014). Gemeinsam mit Spirit Fest, Hugo Race, Lucrecia Dalt, Liz Harris, Lawrence English und all den anderen an einer besseren Welt zu bauen, wäre und ist doch mal was, wir werden einander brauchen, wir werden mobil sein müssen, und wir werden die ganze große Welt in ihrer Gänze, das sie konstituierende Klima nicht aus dem Blick lassen dürfen. Stellen wir es uns einfach vor. Und dann machen wir los. So einfach und kompliziert ist das dann wohl. Keine Zeit für Idioten und nur scheinbar einfache Lösungen, people. We are the people. Und – im Falle der Krakeelenden und falschen Freunde blöderweise – they auch. So sieht das nämlich aus. Wobei das eigene Verwickeltsein in Machtgefüge seitens der kritisch Beobachtenden die Sache nicht trivialer macht: „Das Ergebnis ist die Verunmöglichung dessen, was vonnöten wäre: eine breite Koalition progressiver, emanzipativer Kräfte, die sich gegen die enge Koalition der superreichen Erzkonservativen und der hemmungslos faschistoiden Populisten stellt.“ (Heiser 2018: 107)
Und um also gewissermaßen betrübt und vergnügt zugleich, also nennen wir es doch mal lebensnah wieder vorläufig zu enden und alle diese losen, umherschwirrenden, von Popmusik und Zeitgeist ausgelösten Gedanken nochmals zu bündeln und auch einen Ausblick geben zu können, sei der italienische Medienaktivist, Medientheoretiker und Autor Franco Berardi zitiert, der aktuell im „Kunstforum International“ gewohnt schonungslos die Transformation des Konzepts ‚Zukunft‘ von Hoffnung zu Angst, von Futurismus zu Trumpismus, von futuristisch zu post-futuristisch beschrieb: „Ich weiß nicht, ob diese neue Bewegung in der Lage sein wird, die tödlichen Auswirkungen des Kapitalozäns zu stoppen, oder ob diese Generation es schaffen wird, die Auswirkungen der extraktivistischen Aggressivität, des wütenden Ethno-Nationalismus, der militärischen Macht und der Kriege rückgängig zu machen. […] Was ich jedoch für möglich halte, ist eine Transformation der Erwartungen, Lebensstile und der psychologischen Investitionen. […] Am Ende des Beschleunigungszirkels zeichnet sich ein Aussterben ab.“ (Berardi 2020: 114) Und weiter: „Indem Zukunft mit Entwicklung gleichgesetzt wurde, wurde die Erschöpfung als das Verschwinden der Zukunft selbst wahrgenommen.“ (Berardi 2020: 115) Dass sich daraus ergäbe, dass Zukunft keine Bedeutung mehr habe und die Provokation des ’no-future‘ der Punkkultur in der Mehrheit der Gesellschaft angekommen sei, erscheint allerdings sehr plakativ und wenig sensibel für vor allem das Zeichenauslöschenwollen des Art School Punk (siehe oben die ersten Rezensionen dieser Kolumne, die dort durchaus anschließen). Die Schlussfolgerungen von Berardi klingen dann doch wieder überlegter: „Soziales Glück oder Unglück hängen in der Regel nicht von der Menge des Geldes ab, das in der Wirtschaft zirkuliert, sondern sie hängen von der Verteilung des Reichtums und von der Ausgewogenheit kultureller Erwartungen und der Verfügbarkeit physischer und semiotischer Güter ab. […] Wachstum ist (daher) eher ein Kulturkonzept als ein wirtschaftliches Kriterium, um die gesellschaftliche Gesundheit und das Wohlergehen zu beurteilen. Es ist mit dem modernen Konzept von Zukunft als eine endlose Entwicklung verbunden.“ (Berardi 2020: 117) Und das wiederum führt zu konkreten Konzepten wie beispielsweise dem des Index des guten Lebens in Ecuador. Dort wurden für das menschliche Glück vier Bedürfnisse identifiziert, die neben den sowieso erwartungsgemäß wichtigen der Gesundheit und materiellen Absicherung als eigenständiges relationales Gut dienen: selbstbestimmte Arbeit, Muße und Bildung, soziale Beziehungen und Teilhabe am öffentlichen Leben (vgl. Burchardt 2020, vgl. auch Berardi 2020, Günzel 2020a).
Wir bewegen uns also einerseits mikroperspektivisch in popmusikalischen Welten in Form von in den letzten Jahren erschienenen Alben, über die eigene Rezension und Einordnung landen wir immer wieder makroperspektivisch im Großen und Ganzen des Zeitgeists und der Welten, in denen wir leben. Mesoperspektivisch kann hier also Pop, ob mit oder ohne Corona, als Brennglas und Seismograph gelesen werden, Berardi bildet hier eine solche schnittstellenhafte Position des progressiven Antitums aus. Womit wir wieder bei dem eingangs erwähnten Zitat von Sippenhauer aus der letzten Print-Ausgabe der Spex angekommen wären. Und ’so far‘ wieder abbrechen, nicht ohne ein Outro zu liefern – ‚from now on‘ sozusagen, prosaisch, lyrisch und bildlich.
Outro
Ein Monat! Welch falsches, unsicheres Versprechen! Zwei, vielleicht drei, was wusste ich! Vielleicht würde uns bald noch mehr trennen?
Gustafsson 2020: 7
So miete ein Museum und sieh dich selbst in Spiegeln –
In jedem Raum eine Ausstellung einer anderen Phase deines Lebens
mit all deinen Gestalten und Gesichtern
und Bildern all der Menschen die dich durchmessen haben
und all den Szenen die du durchmessen hast
all den Landschaften des Lebens und Sehnens und Wollens und Gebens und Kriegens und Tuns und Sterbens
und Seufzens und Lachens und Weinens (was für ein Gekasper!)
Ferlinghetti 2005: 143

Text: Christoph Jacke
[togglegroup][toggle title=“Literatur“]
ASSHEUER, Thomas (2020): Die Heimsuchung. Schon immer haben Seuchen die kulturelle Fantasie angesteckt. Der Verdacht lautet: Die Zivilisation habe es nicht anders verdient. Wie zynisch. In: Die Zeit. Nr. 14 vom 26.03.2020, S. 49-50.
BADIOU, Alain (2017): Trump. Amerikas Wahl. Wien: Passagen.
BALZER, Jens (2019): Pop und Populismus. Über Verantwortung in der Musik. Hamburg: Edition Körber.
BERARDI, Franco (2020): Zukunft: Erschöpfung. In: Kunstforum International. Band 267 (Mai 2020): post-futuristisch. Kunst in dystopischen Zeiten, S. 112-117.
BURCHARDT, Hans-Jürgen (2020): Vom Wert der Zeit. Die Corona-Krise wirft nicht nur die Frage auf, wie wir leben wollen – sie bietet auch die Chance, über Wohlstand jenseits von Geld und Gütern zu verhandeln. In: Frankfurter Rundschau. 76. Jahrgang. Nr. 88 vom 15.04.2020, S. 16-17.
DIEDERICHSEN, Diedrich (2017): Körpertreffer. Zur Ästhetik der nachpopulären Künste. Berlin: Suhrkamp.
FERLINGHETTI, Lawrence (2005): A Coney Island of the Mind. A Far Rockaway of the Heart. Gedichte. München: Sammlung Luchterhand.
FISHER, Mark (2017): Das Seltsame und das Gespenstische. Berlin: Tiamat.
GOETZ, Rainald (2015) [1986]: Irre. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
GOETZ, Rainald (2008): Klage. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
GROSSBERG, Lawrence (2012): Cultural Studies – Zukunftsform. Wien: Erhard Löcker.
GÜNZEL, Ann-Kathrin (2020a): asap. Mit Höchstgeschwindigkeit in die Zukunft. In: Kunstforum International. Band 267 (Mai 2020): post-futuristisch. Kunst in dystopischen Zeiten, S. 48- 73.
GÜNZEL, Ann-Kathrin (2020b): post-futuristisch. Kunst in dystopischen Zeiten. Editorial. In: Kunstforum International. Band 267 (Mai 2020): post-futuristisch. Kunst in dystopischen Zeiten, S. 46- 47.
GUSTAFSSON, Lars (2020): Dr. Weiss‘ letzter Auftrag. Göttingen: Wallstein.
HABERMAS, Jürgen (2020): „So viel Wissen über unser Nichtwissen gab es noch nie“. Der Philosoph Jürgen Habermas über den aktuellen Zwang, unter Unsicherheit handeln und leben zu müssen, und über seine frühe Impfung gegen den Sog von Nietzsches Prosa. In: Frankfurter Rundschau. 76. Jahrgang. Nr. 83 vom 07.04.2020, S. 22-23.
HEISER, Jörg (2018): Von Beruf unschuldig. Politik der Kunst und die Sündenbock-Funktion. In: Kunstforum International. Band 254 (Kuni/Juli 2018): Politik, Ethik, Kunst. Kultureller Kilmawandel – Strategien und Werkzeuge, S. 104-115.
JACKE, Christoph (2000): Wirklichkeits-Crossover: einige Beobachtungen zu den spielerischen Ersatzkriegen Big Brother und „EM 2000“. In: Weber, Frank (Red.): Big Brother. Inszenierte Banalität zur Prime Time. Münster, Hamburg, London: LIT, S. 179-193.
JACKE, Christoph (2013): „Lies (through the 80s)“. Immer gleich und besser. In: Meinert, Philipp; Seeliger, Martin (Hrsg.): Punk in Deutschland. Sozial- und kulturwissenschaftliche Perspektiven. Bielefeld: Transcript, S. 189-208.
JACKE, Christoph (2016a): Big Black: Songs about Fucking. In: Engelmann, Jonas (Hrsg.): Damaged Goods. 150 Einträge in die Punk-Geschichte. Mainz: Ventil, S. 201-203.
JACKE, Christoph (2016b): Swell Maps: A Trip to Marineville. In: Engelmann, Jonas (Hrsg.): Damaged Goods. 150 Einträge in die Punk-Geschichte. Mainz: Ventil, S. 92-93.
JACKE, Christoph (2017): „Zu Tode betrübt“ oder „Immer lustig und vergnügt“? Pop, Agonistik, Postdemokratie und Trumpismus. Essayistische Einwürfe. In: Hoyer, Timo; Kries, Carsten; Stederoth, Dirk (Hrsg.): Was ist Popmusik? Konzepte – Kategorien- Kulturen. Darmstadt: WBG, S. 177-183.
JACKE, Christoph (2020): Rowland S. Howard. „Teenage Snuff Film” / „Pop Crimes”. In: Kaput. Magazin für Insolvenz & Pop. Online: https://kaput-mag.com/critics_de/rowland-s-howard-teenage-snuff-film-pop-crimes/ (Abruf 24.03.2020).
JACKE, Christoph; MENDÍVIL, Julio (2019): Heimat 2.0. Über Konstruktionen und Imaginationen von Beheimatung in der deutschsprachigen Schlagermusik. In: Brinkmann, Frank Thomas; Hammann, Johanna (Hrsg.): Heimatgedanken. Theologische und kulturwissenschaftliche Beiträge. Wiesbaden: Springer VS, S. 45-66
JULLIEN, Francois (2017): Es gibt keine kulturelle Identität. Berlin: Edition Suhrkamp.
KREUZMAIR, Elias (2017): Nicht auf die Schnauze gefallen. In: Taz – Die Tageszeitung vom 01.09.2017, S. 15.
MIKAEL MIKAEL (2015): Blackout. Berlin: Merve.
MISIK, Robert (2019): Die falschen Freunde der einfachen Leute. Berlin: Suhrkamp.
PAUSCH, Robert; RAETHER, Elisabeth; ULRICH, Bernd (2020): Plötzlich Elite. In der Krise offenbart sich: Systemrelevant sind die Unterbezahlten. Wie das Virus die soziale Frage neu aufwirft. In: Die Zeit. Nr. 15 vom 02.04.2020, S. 3.
PIKETTY, Thomas (2020): Kapital und Ideologie. München: C.H. Beck.
RECK, Hans Ulrich (2018): Erfolg, wider Erfolg. In: Kunstforum International. Bd. 254 (Juni/Juli 2018), S. 40-43.
SEESSLEN, Georg (2018): Is This The End? Pop zwischen Befreiung und Unterdrückung. Berlin: Edition Tiamat.
SIPPENHAUER, Maximilian (2018): Feuer, Wasser, Endzeitbingo. Kleine Geschichte der Anti-Haltung. In: Spex – Magazin für Popkultur. Heft 381 (Juli/August 2018), S. 25-26.
THEWELEIT, Klaus (2018): Wie wir leben woll(t)en 1968 vs. 2018. Stimuliert bis zum Unaushaltbaren. In: Spex. Heft 380, S. 68-71.
ULRICH, Bernd (2020): Apocalypse, not now. In: Die Zeit. Nr. 13 vom 19.03.2020, S. 13-14.
[/toggle][toggle title=“Platten“]
V/A, „Noise Reduction System: Formative European Electronica 1974-84“, Cherry Red, 2017.
The Fall, „New Facts Emerge“, Cherry Red 2017.
Television Personalities, „Beautiful Despair“, Fire Records 2018.
Go-kart Mozart, „Mozart’s Mini Mart“, West Midlands/Cherry Red 2018.
Chris Carter, „Chris Carter’s Chemistry Lessons Volume One“, Mute 2018.
Autobahn, „The Moral Crossing“, Tough Love 2017.
Geowulf, „Great Big Blue“/“My Resignation“, 37 Adventures 2018/PIAS 2019.
Ride, „Weather Diaries“/“This Is Not a Safe Place“, Wichita 2017/2019.
Alvvays, „Antisocialites“, Transgressive 2017.
Zola Jesus, „Okovi“, Sacred Bones 2017.
Metz, „Strange Peace“, Sub Pop 2017.
No Age, „Snares Like a Haircut“/“Goons Be Gone“, Drag City 2018/2020.
Wax Chattels, „Wax Chattels“, Flying Nun 2018.
Mogwai, „Every Country’s Sun“, Rock Action 2017.
Heads, „Push“, Glitterhouse 2020.
Widowspeak, „Expect the Best“, Captured Tracks 2017.
Anna Burch, „If You’re Dreaming“, Heavenly Recordings 2020.
Pottery, „Welcome to Bobby’s Motel“, Artisan 2020.
Ghostpoet, „I Grow Tired But Dare Not Fall Asleep“, Pias 2020.
White Wine, „Killer Brilliance“, Altin Village & Mine 2017.
Der Plan, „Unkapitulierbar“, Bureau B 2017.
Östro 430, „Keine Krise kann mich schocken (die kompletten Studioaufnahmen 1981-1983)“, Tapete 2020.
Mutter, „Der Traum vom Anderssein“, Die eigene Gesellschaft 2017.
AUF, „Getimed“, Klangbad 2018.
V/A, „Die Liebe frisst das Leben“, Zickzack/Mindjazz 2020.
Königliche Braut, „Scheiss Geschenke“, Königliche Braut 2017.
Lali Puna, „Two Windows“, Morr Music 2017.
Spirit Fest, „Spirit Fest“/“Anohito“/“Mirage Mirage“, Morr music 2017/2018/2020.
1115, „Post-Europe“, Alien Transistor 2017.
Mark Pritchard, „The Four Worlds“, Warp 2018.
Lawrence English, „Cruel Optimism“ 2017.
Ben Frost, „The Centre Cannot Hold“, Mute 2017 (+ „Threshold of Faith“, Mute 2017 + „All That You Love Will Be Eviscerated“, Mute 2018).
Hannu Karjalainen, „A Handful of Dust is a Desert“, Karaoke Kalk 2017.
Anjou, „Epithymía“, kranky 2017.
Sonae, „I Started Wearing Black“, Monika 2018.
Lucrecia Dalt, „Anticlines“, Rvng Intl 2018.
Grouper, „Grid of Points“, kranky 2018.
The Sea and Cake, „Any Day“, Thrill Jockey 2018.
Damien Jurado, „Horizon Just Laughed“/“What’s New, Tomboy?“, Secretly Canadian 2018/ Loose 2020.
Nadia Reid, „Preservation“/“Out of my Province“, Basin Rock 2017/ Spacebomb 2020.
Spiritualized, „And Nothing Hurt“, Bella Union 2018.
Jackie Lynn, „Jaqueline“, Drag City 2020.
Shabazz Palaces, „The Don of Diamond Dreams“, Sub Pop 2020.
Dirtmusic, „Bu Bir Ruya“, Glitterbeat 2018.
Catherine Graindorge/ Hugo Race, „Long Distance Operators“, Sub Rosa 2017.
Lydia Lunch & Cypress Grove, „Under the Covers“, Rustblade 2017.
Rowland S. Howard, „Teenage Snuff Film“/“Pop Crimes“, Mute 2020.
[/toggle][toggle title=“Hör|Spiel“]
[/toggle][/togglegroup]