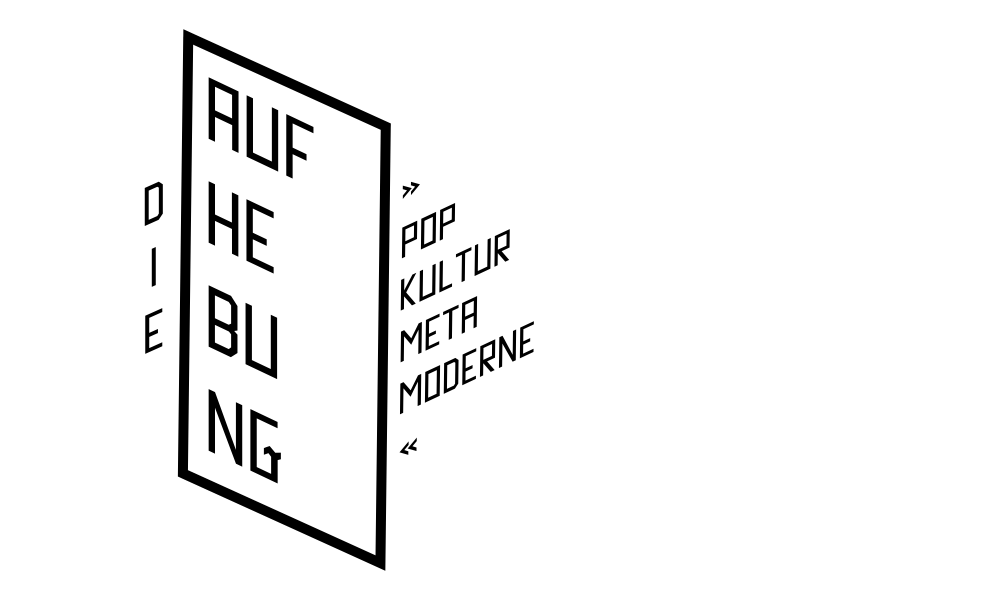Die Aufhebung — Positionen.
© Michelangelo Antonioni, »Zabriskie Point«, 1970. Quelle: Youtube.
Eine Empörung.
Ihr, die ihr ›Pop‹ auf die Schulter klopft, ganz so als wäret ihr alte Freunde, die sich blind verstehen. Ihr, die ihr smart lächelt und artig abnickt, um dann – maskiert in der Coolness eines notwendig falschen Bewusstseins – in die Tasten zu hämmern: Ihr seid fett geworden! Handzahm und behäbig. Never bite the hand that feeds you. Und was sie euch füttert! Opulente Illusion von Kaviar und Trauben, Wachteleiern und Martini — Filetstücken! Gästelistenplätze! Vakuumverpackter Sex-Appeal ohne Verfallsdatum! Mit vor Fett triefender Rückhand wischt Ihr die Essensreste des letzten Gelages aus den Mundwinkeln, die Augen wollüstig funkelnd ob der Erektion im eigenen Spiegelbild. Ihr merkt nicht, dass euch die Arterien verkalken. High vor Bluthochdruck dreht Ihr euch im Kreis, denkt, Ihr tanzt gemeinsam. Nur gedämpft und weit entfernt vernehmt Ihr das Knacken der Scherben unter euren Chucks. Noch ist die Party nicht vorbei, doch es sind die letzten Wogen ironischer Glückseligkeit, die an eure Synapsen branden. Illusion bleibt Illusion, Fata Morgana, Traumwelt. Die Kulisse: Götzendämmerung. Noch im Widerhall des letzten Beats werdet Ihr verwundert mit den Augen blinzeln, euch mit schweren Gliedern aus den Streben des Hamsterrads erheben, das euch zeitlebens als Federbett erschien; werdet vor dem Spiegel stehen, vergrämt über die Augenfältchen streichen und die kühle Abwesenheit der so alltäglich gewähnten Erektion betrauern. Where the fuck is ›Pop‹? werdet Ihr fragen. Klammheimlich weitergezogen, auf der Suche nach achtsamen Zuhörern, die sich nicht lediglich in einem lüsternen Akt kleinbürgerlichen Aufmerksamkeits-Kannibalismus’ die schillernde Fassade einverleiben.
Prolog — Die Mitte ist der Anfang.
Es ist an der Zeit, die Lunte zu zünden; ihr entgegengesetztes Ende baumelt im Kerosintank. Warum? Weil wir Pyromanen sind. Tief drinnen, da, wo es schmerzt. Wenn es knistert und Funken sprühen, bekommen wir feuchte Hände. Dann zerhackt der rasende Puls das ewige Verstehen-Wollen. Überhaupt: Verstehen, Erklären, Kategorisieren, den Überblick behalten: alles antiquierte Geschichten. Dann taumeln wir blindlings hinein in die Explosion; in den elementaren Regen der voller jouissance zerfetzten Einheit; wollen uns die Schrapnelle des Identitären ins Gesicht klatschen lassen. Schmerzen muss es! Sonst ist es kaum mehr als aufgeblasenes Spektakel — mediales Adrenalin-Surrogat.
Jetzt ist es ist an der Zeit, die Lunte zu zünden, um zu sehen, an welchen Zeitort uns die Druckwelle versprengt. Vielleicht in den Orbit. Raus aus der Linearität, rein in die Simultaneität, raus aus der Banalität normierter Erzählungen, rein in die Komplexität, die Unübersichtlichkeit — auf der Überholspur ins Chaos.
Metamoderne.
Wie sieht sie aus, die ›Popkultur‹ unserer Zeit? Wenn wir sie stellen, setzt diese Frage auf einem im vergangenen Jahrzehnt immer virulenter gewordenen Gedanken auf: In welchem Zeitalter leben wir? Im Licht von Finanz- und Umweltkrise und der immer weiter voranschreitenden Demokratisierung digitaler Technologien keimen Zweifel an unseren Grundsätzen und der Wunsch nach Reflexion.(1) Der Postmoderne-Diskurs samt seines proklamierten Endes der Geschichte scheint von ebendiesen – gewissermaßen nach-historischen – Entwicklungen überrumpelt und sich der Eineindeutigkeit und Gültigkeit seiner (vielen) Selbstabbildungen nicht mehr gewiss zu sein. Vielmehr entwickelt sich der Plural der Klarheiten hin zu einem temporären Schärfestadium in der Oszillation zwischen Moderne und Post-Moderne. Zwischen, so beschreiben es der niederländische Kulturtheoretiker Timotheus Vermeulen (Department of Cultural Studies, Radbout Universiteit Nijmegen) und der Kulturphilosoph Robin van den Akker (Department of Philosophy, Erasmus Universiteit, Rotterdam), »dem modernen Wunsch nach Sinnstiftung und dem postmodernen Zweifel am Konzept der Sinnhaftigkeit, zwischen moderner Aufrichtigkeit und postmoderner Ironie, zwischen Hoffnung und Melancholie, Empathie und Apathie«(2). In dieser Oszillation entdecken Vermeulen und van den Akker eine neue Epoche, die weniger Epoche im Sinne eines Strebens nach begrifflicher Fixierung ist, als (nach Raymond Williams) »eine bestimmte Beschaffenheit sozialer Erfahrung […] historisch abgetrennt von anderen, die das Gefühl einer Generation oder eines Zeitabschnitts vermittelt.«(3) Diesen Zeitabschnitt fassen beide unter dem Begriff der Metamoderne (›metamodernism‹). Dabei steht das Meta-Präfix nicht im Zeichen eines selbstreflexiven Beobachtens, sondern fungiert – im Sinne der platonischen metaxis – sinnbildlich als Indikator einer dynamischen Bewegung.
Die Aufhebung.
Am ›Pop‹, vor allem an der ›Popmusik‹, sind die vergangenen zehn Jahre nicht spurlos vorübergegangen. Dabei war es vor allem ein Diskurs, der die Stimme lauter zu erheben schien als alle Anderen: Simon Reynolds’ ›Retromania‹-Diagnose. Deren Manie-Fragment spiegelt sich in, einander mit aberwitziger Geschwindigkeit überholenden, mitunter überlagernden Moden. Im pedantischen Verweisen auf Authentizität, das jedoch über das bloße weiterverweisen niemals hinauskommt — dem Verklären des Authentischen zur Spur. Gleichzeitig bieten neue Medien schier endlose Kapazitäten zur zeitsynchronen und ent-orteten Speicherung, was zu einer Art archivarischem Tumor führt; zum verbissenen Willen, »einen Raum aller Zeiten zu schaffen, [so] als könnte dieser Raum selbst endgültig außerhalb der Zeit stehen«(4). Das Ende des Vergessens? Nicht zuletzt ist es unsere alltägliche Lebenswelt, in der sich die Omnipräsenz von ›Popmusik‹ in jedweder Schattierung nicht leugnen lässt: von Myriaden an Casting-Shows über individualisiertes Internetradio und Youtube bis hin zum Spotify-Abonnement im Handyvertrag und der eigenen Musik in Computerspielen. Gleichwohl macht die Arbeit mit ›Pop‹ lediglich arm aber sexy — zum Slogan verdichteter, feuchter Traum des Kapitals: Effizienz im Pelz der Dissidenz!
Dieser rasenden Entwicklung scheint indes das Gros des deutschsprachigen Pop-(Musik)journalismus entweder verzweifelt nachzuhecheln oder begegnet ihr in der Opposition mit fetischisierter Kanonpflege. Doch zwischen den Extremen hastiger Reproduktion und Nostalgieversessenheit klafft ein hermeneutischer Riss, aus dessen Mitte ein breiter Fluss unbeantworteter Fragen entspringt: Wir reden in inflationärem Ausmaß davon, aber: was heißt (gegenwärtig) eigentlich ›Pop‹, was ›Pop-Kultur‹, was ›Populär‹? Welche Rolle spielt ›Pop-Kultur‹ in Zeiten des Alles-ist-möglich? Spielt sie überhaupt noch eine Rolle oder ist ihr im postmodernen Salto mortale die Relevanz aus der Hosentasche gerutscht? Ist ihre unentrinnbare Präsenz das fratzenhafte Antlitz einer hochgerüsteten spätkapitalistischen Gesellschaft? Oder versucht sie, über das schillernde Außen hinweg, aktuelle Befindlichkeiten zu artikulieren und das Problem liegt vielmehr bei uns, die wir vor lauter Reizüberflutung die Fähigkeit des aufmerksamen Zuhörens verloren haben? In welchem Verhältnis steht Sie zur Kunst? Und zur Politik — gibt es noch Subversion im ›Pop‹? Wie steht sie zur Gesellschaft? Und nicht zuletzt: wo und – noch wichtiger – wie positionieren wir uns selbst zu ›Pop‹?
Unser persönliches, kindlich-naives Glaubensbekenntnis zur ›Popkultur‹ nötigt uns zu einem, nicht ohne den Gestus der Verunsicherung vorgetragenen: Da-steckt-mehr-dahinter. Wir behaupten, dass es an der Zeit ist, den ›Pop unserer Zeit‹ – was genau das heißt, gilt es herauszufinden – ernst zu nehmen, um ihn einer kritischen Diagnose zu unterziehen. Dieses Ernst-nehmen impliziert einerseits die Grundannahme, dass ›Pop‹ kein Selbstzweck ist, sondern über seine bloße Existenz hinaus ernst genommen werden muss! ›Pop‹ erzählt, also fragen wir auf möglichst vielen Ebenen, möglichst präzise nach den Erzählweisen und Politiken von ›Pop‹. Und dort, wo er reduktionistisch und reaktionär agiert, sollten wir ihm den Spiegel vorhalten.
Andererseits: Was wäre ›Pop‹ ohne Vergnügen und Fantum? Deshalb wollen wir – in emphatischem Sinne – entdecken, Scheiße-finden, Gut-finden, geschmäcklerisch debattieren und: Empfehlungen aussprechen, wieder Gatekeeper sein. Wir fragen unablässig: Was machst du so, ›Pop‹? Morgen Abend schon was vor oder sollen wir uns dionysisch berauschen, über die ›ästhetische‹ Beurteilung deiner Exponate streiten und im erzürnten Gestikulieren das Bier vom Tresen fegen? Was auch heißt: unser Schreiben über ›Pop‹ ist ›Pop‹! Ergo: Radikale Affirmation des Affektiven! Schluss mit dem obsolet gewordenen Anspruch schnöder Objektivität!
Das ist die Aufhebung: der Widerspruch; die Implosion — der tote Winkel im Aufeinanderprallen von Reflexion und Affekt. Wir wollen nicht einmal ansatzweise versuchen, den Spagat zwischen Subjektivität und Objektivität zu vollziehen, um letztlich im Limbus selbstironischer Lähmung zu enden. Im Gegenteil: beides gleichzeitig sein. Verkörperte Differenz — ein Hoch auf die Schizophrenie! ›Organloser Körper‹! Stetige Kollision! Neuvernetzung! Die Herausforderung dieses Projekts liegt genau hier: die Lust am ›Populären‹ mit der Kritik am Primat der Lust zu vereinen. Kontinuierliches Verhandeln als Chance, um Meinung zu äußern, um angreifbar zu sein, revidieren zu müssen, falsch zu liegen. Die Maxime: so komplex wie nötig, so viel Leidenschaft wie möglich.
Im Hinblick auf das schemenhafte Epochenkonstrukt der Metamoderne ist es vor allem ein wesentliches Unschärfe-Moment, das wir in der gegenwärtigen ›Pop-Kultur‹ ausmachen, was uns interessiert. Denn: ist es nicht gerade die phänomenale Ungreifbarkeit, die ›Pop‹ so spannend macht? Das ›Pop-Up-Moment‹, was als Zerrbild durch das warenhafte Äußere schimmert: das Glücksversprechen, die Sexyness, das Andere? Das Moment der Verwirrung, das wir nicht akzeptieren können, weil es uns selbst in Frage stellt?
Epilog — Kontingenzpläne machen.
Wie irre rasen wir. Im Rausch der Geschwindigkeit beginnt die Wahrnehmung zu schmieren. Jetzt LINKS abbiegen. Da hinten!: Spur der Kurve. Und weiter. Kreuzung. Augen zu. Den TRANSVERSALEN Abzweig nehmen, taktil werden. Lücke im Asphalt. Wie Keanu Reeves in ›Speed‹ agieren. Zum Geschoss werden. Augen zu und drüber. Der Kartograph stenokartiert wie wahnsinnig, zeichnet entformte Gebilde, die sich verselbstständigen, sich die Hände schütteln, für den Moment zu Geistern werden. Ist das nicht…? Nichts ist, nichts war, alles wird. Immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer Meer.
[accordiongroup][accordion title=“Quellen“]
(1) Vgl. van den Acker, Robin; Vermeulen, Timotheus (2010): What is metamodernism?. http://www.metamodernism.com/2010/07/15/what-is-metamodernism/ (27.12.2013)
(2) ebd.
(3) Williams, Raymond (1977): Marxism and literature. Oxford: Oxford University Press. S. 131.
(4) Foucault, Michel (2013): Die Heterotopien. In: Michel Foucault: Schriften zur Medientheorie. Berlin: Suhrkamp. S. 123.[/accordion][/accordiongroup]