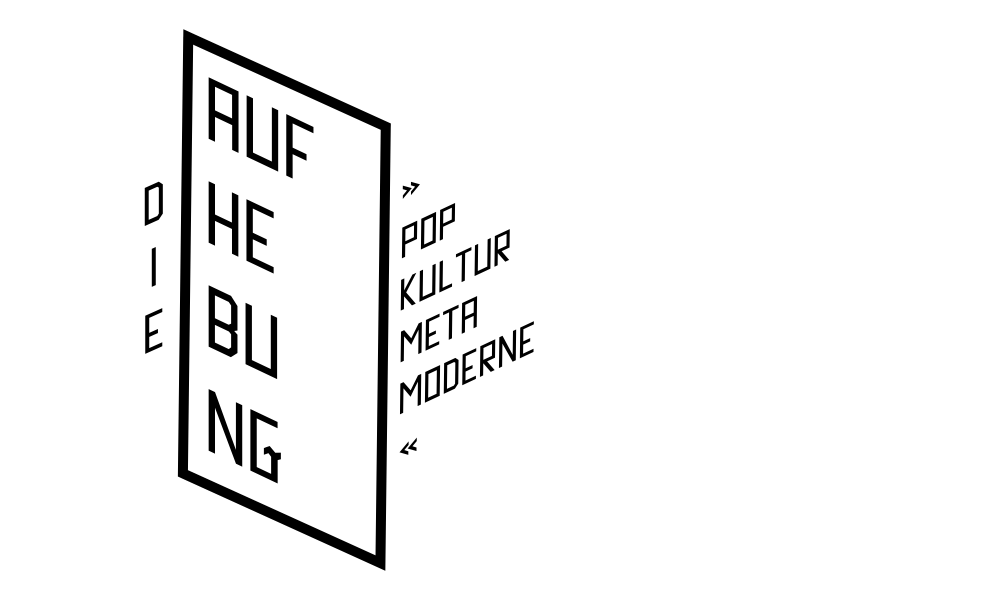Er ist tief, düster und gespenstisch, der Irrgarten, in dessen Innern die Popmusik im vergangenen Jahrzehnt rast- und ratlos irrlichterte. Der passionierte Pop-Fan: Nietzsches Wiedergänger, verdammt zur quälenden Erkenntnis der Wiederkehr des Ewig-Gleichen. ›Hauntology‹ labelte Simon Reynolds damals jenes musikalische Phänomen, welches sich unter anderem in der Musik von Ariel Pink oder den Boards Of Canada manifestierte. Das Bezeichnende dieser popkulturellen Strömung, das sich über die Grenzen des Musikalischen hinaus auch in die Oberflächen von Mode-, Film- und Videospielästhetiken einschrieb, lag dabei weniger in stilistischen Besonderheiten, als vielmehr in einer bestimmten Art der Auseinandersetzung mit Vergangenheit. Es äußerte sich einerseits im freizügigen Recycling der Popgeschichte, die im eklektischen Remix Einzug in die Musik hielt. Andererseits erkoren die Hauntologen dem Vergessen anheim gefallene Musiktechnologien zum Fetischobjekt. Und so geisterte unversehens das Knacken einer Schallplatte oder das Rauschen alter BASF-Kassetten durch die Untiefen unzähliger MP3-Files. Ursprünglich stammt der Begriff aus dem Œvure des französischen Philosophen Jacques Derrida, einem Taufpaten des Poststrukturalismus. Mit ›hantologie‹ schuf er seinerzeit einen Neologismus aus Spuk – französisch: la hantise – und Ontologie, der philosophischen Lehre des Seins und den Wesensbestimmungen des Seienden. »Spuken«, schrieb Derrida damals, »heißt nicht gegenwärtig sein, und man muss den Spuk schon in die Konstruktion eines Begriffes aufnehmen« (1). Im Kielwasser der Derrida’schen hantologie schwimmt ein weiterer gewichtiger Begriff aus dessen Theorie-Konvolut: die Spur — ein Ursprung, der keiner mehr ist. Im geisterhaften Knacken und Rauschen steckt also der Verweis auf die Materialität der Platte oder des Magnetbands der Kassette, ohne dass diese Technologien jedoch im Medium des Files angelegt wären. Das Gespenst existiert nicht an sich, sondern offenbart sich lediglich in der verhuschten Präsenz eines bereits Vergangenen — oder: in der Antizipation eines Zukünftigen.
Während die Beschwörung der Vergangenheit im Pop während des vergangenen Jahrzehnts etliche Zyklen der Reanimation durchlief (einmal mehr verdichtet in einem Begriff von Simon Reynolds: ›Retromania‹), steht es um die Zukunft weit weniger rosig. Der immanente Fortschrittswille, Schlagschatten der Popgeschichte seit ihrer Verquickung mit den Freuden des Konsumkapitalismus, scheint mit der Jahrtausendwende im – wie es im Englischen so schön heißt – Deadlock der Zukunftsmüdigkeit gestrandet zu sein. Dabei erweckt es den Eindruck, als wäre die Müdigkeit als solche Teil des Krankheitsbilds: Der italienische Kulturkritiker Franco Berardi erkennt sie als Effekt einer unheilvollen Verzahnung von prekarisierter Arbeit und digitaler Kommunikationstechnologie. (2) Flexibilisierung (vor allem in der Informationsarbeit) gekoppelt mit der beschleunigten Zeit des virtuellen Raums erzeugen eine Sphäre konstanter Überreizung, die zur Apathie gegenüber den erotischen Verlockungen kultureller Güter führt. »Retro verspricht«, schreibt Mark Fisher in Gespenster meines Lebens, »eine schnelle und bequeme Lösung, durch die nur minimale Variation schon vertrauter Befriedigung« (3). Zukunft is too sexy for my love.
Und doch spuken gelegentlich und mit aller gebotenen Diskretion – dem geschärften Blick des Ghostbusters unentrinnbar – Geister der Verheißung durch den popmusikalischen Kosmos. Jene zum Beispiel, die den Mauern des Brainfeeder-Labels entstammen. Sie heißen Flying Lotus, Ras G And The African Space Program, Thundercat oder – jüngster Neuzugang im Labelkatalog – Kamasi Washington. Ihre Musik spielt jenseits der kartografierten Gebiete von Hip Hop, Breakbeat, Jazz und Funk und gelegentlich auch jenseits dieses Planeten.
› Black Elvis Lost in Space ‹
Gleichwohl geht es auch im Rahmen des Brainfeeder-Universums um Spurensuche. Die Fährten der musikalischen Ahnen sind noch verhältnismäßig frisch und lassen sich entsprechend mühelos zurückverfolgen, zu Sun Ra, John und Alice Coltrane (deren engerem Verwandtschaftskreis auch Flying Lotus angehört), Herbie Hancock, Parliament, Lee Perry, Afrika Bambaata oder auch Kool Keith. Was sie allesamt eint ist – im Gegensatz zur eher nostalgischen Verklärung der Vergangenheit bei den Hauntologen – ein besonderes Verhältnis zur Zukunft, das wiederum unablösbar an den symbolisch beladenen Begriff der Rasse gekoppelt ist. ›AfroFuturism‹ betitelte die Soziologin Alondra Nelson 1999 – damals noch als Doktorandin an der New York University – ein Forum, in dem sie Beiträge zur afroamerikanischen Kultur sammelte, die eben jene besondere Sensibilität teilten. Die Ursprünge des Begriffs liegen indes sechs Jahre zuvor in einem Sammelband des amerikanischen Kulturkritikers Mark Dery, der neben Gesprächen mit den Geisteswissenschaftlern Tricia Rose und Greg Tate auch Samuel R. Delaney, einen afroamerikanischen Science Fiction-Autor, interviewte. (4) Wie auch Hauntology, überwindet der Afrofuturismus die Grenzen der Musik, um sich in Literatur (insbesondere Science Fiction von Autoren wie William Gibson, Octavia Butler, Toni Morrison oder zuvor erwähntem Samuel R. Delaney), Comic (z.B. Hardware, Afro Samurai), Film (z.B. The Brother From Another Planet, Blaxploitation) und Kunst zwischen Street Art (Rammellzee) und Hochkultur (Jean-Michel Basquiat) einzunisten.
Die – im Derrida’schen Sinne – kulturelle Ur-Spur des Phänomens reicht jedoch bis tief in die Wurzeln der Moderne im 17. Jahrhundert zurück. Für die westlichen Gesellschaften begann zu jenem Zeitpunkt mit René Descartes’ Leib-Seele-Dualismus die segensreiche Epoche der Aufklärung. Ihr verdanken sie die Verbannung der Religion ins Reich der Mythen zugunsten einer allumfassenden Vernunftbestimmtheit. Die wiederum lieferte das Fundament für die modernen Wissenschaften, mithin den Nährboden für Emanzipation und nicht zuletzt die Möglichkeit der Selbstbestimmung als vernunftbegabtes Subjekt. Für die Geschichtsschreibung afroamerikanischer Kultur hingegen markierte dasselbe Moment einen historischen Nullpunkt. Im Zuge des atlantischen Sklavenhandels (der sogenannten Middle Passage) durchliefen Abertausende, der Freiheit beraubter Afrikaner die traumatisierenden Erfahrungen von Heimatlosigkeit, kultureller Entwurzelung und vor allem: Dehumanisierung. Der Sklave galt als das Subhumane im Dienste der weißen Existenz, dem jegliches Recht, das ihm ein Mindestmaß jenes vom Westen so hoch gehandelten Wertes der Menschlichkeit garantiert hätte, abgesprochen wurde. In diesem Licht betrachtet, ist das vermeintliche Postulat eines afroamerikanischen Subjekts kaum mehr als die zynische Pointe des aufklärerischen Humanismus, da es bis zum Ende der Sklaverei im 19. Jahrhundert de facto nicht existierte. Der Kulturkritiker Alexander Weheliye verdeutlichte das einst so: »Im Lichte der Aufklärung bezeichnet afroamerikanische Existenz lediglich den Leib und darüber hinaus nichts« (5). Sofern sich schwarzes Selbstverständnis überhaupt denken ließ, so nur über den Mittler des weißen Subjekts — ein Paradox, das sich noch heute in der Semantik der Bezeichnung ›afroamerikanisch‹ abzeichnet. Sie zieht eben jene strukturelle Unvereinbarkeit, die zwischen afrikanischer Abstammung und der Lebensrealität in einem westlich geprägten Amerika besteht, im Begriff zusammen. Das Bewusstsein dieser sowohl psychologischen als auch gesellschaftlichen Entfremdung beschrieb der Soziologe W.E.B. Du Bois bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts treffend als ›double consciousness‹. (6)
Obendrein erwies sich die Maschinerie der Sklaverei als äußerst effektiv in der Vernichtung kultureller Überbleibsel der vergangenen Zivilisation, lediglich einige Rhythmen retteten sich als Residuen in die Worksongs, die später das Fundament für Jazz und Blues legen sollten. Mit Derrida im Anschlag ließe sich also argumentieren, dass das afroamerikanische Subjekt selbst ein Phantom ist, das auf einen Ursprung verweist, dessen kulturelle Artefakte – von wenigen Ausnahmen abgesehen – minutiös ausgemerzt wurden. Der diffuse Schmerz, den sein generationenübergreifendes Nachhallen wachruft, wurde zum Signum einer Kultur und lässt sich auch heute noch als Projektion im Hintergrund der rassistischen Ausschreitungen von Ferguson oder Baltimore spüren.
Zusätzlich zum verweigerten Subjektstatus fußt ein weiteres – für das Verständnis der Zukunftsaffinität des Afrofuturismus zentrales – Moment in der Logik der daran gebundenen Geschichtsschreibung: Insofern die Aufklärung der versklavten afroamerikanischen Diaspora das westliche Konzept der Subjektivität kategorisch vorenthielt, schloss sie eine ganze Bevölkerungsgruppe vom dominierenden Strang der Geschichte aus. Der Philosoph Walter Benjamin schrieb dazu in einer seiner Thesen zum Geschichtsbegriff: »Wer immer bis zu diesem Tage den Sieg davontrug, der marschiert mit in dem Triumphzug, der die heute Herrschenden über die dahinführt, die heute am Boden liegen. Die Beute wird, wie das immer so üblich war, im Triumphzug mitgeführt. Man bezeichnet sie als Kulturgüter« (7). In dem Maße also, in dem die Aufklärung eine Geschichte der weißen, westlichen (und nebenbei bemerkt: betont männlichen) Erziehung zur Mündigkeit schrieb, gedieh in ihrem Schatten gleichsam eine der schwarzen Unterdrückung. Im Lichte dieser Relation gelesen, sind die Schöpfungen afroamerikanischer Kultur zugleich auch Mahnmal der Barbarei, wie Benjamin schreibt. Ähnlich formulierte das Sun Ra in der Dokumentation A Joyful Noise: »They say that history repeats itself. But history is only his-story, you haven’t heard my story yet.«
› Supersonic Bionic Robot Voodoo Power ‹
Die Fundamente jener besonderen afrofuturistischen Sensibilität liegen also in einem Moment der Revolte: Dem beharrlichen Aufbegehren gegen die verwehrte Teilhabe am Projekt der Aufklärung. Während ein beträchtlicher Teil afroamerikanischer Kulturgeschichte von Martin Luther King über Malcolm X und die Black Panther Party bis in die Gegenwart (z.B. Cornel West) vom unerlässlichen Kampf für Gleichberechtigung geprägt ist (dessen popmusikalischer Arm im Lichte der jüngsten Unruhen derzeit eine neue, ein mal mehr in Soul und Gospel getünchte, Dringlichkeit erfährt — siehe D’Angelo And The Vanguards Black Messiah oder das Debütalbum der Algiers), verfolgt der Afrofuturismus eine gänzlich andere Strategie: Eine Art radikale Bejahung dieser kulturellen Isolation, die in letzter Konsequenz die westlichen Konzeptionen von sowohl Subjektivität als auch Geschichte unterminiert. Dieser Strategie liegt das mythologisierte Konstrukt einer schwarzen Seele zu Grunde, deren Grundfeste auf dem afrikanischen Kontinent zu Zeiten einer längst vergangenen Zivilisation ruhen — so lassen sich etwa im Œuvre von Sun Ra zahlreiche Bezüge auf die Pharaonenzeit im Alten Ägypten entdecken. Auf dem Nährboden des Mythos wächst ein Modell schwarzer Authentizität heran, dessen Kraft sich vor allem aus einer Art Voodoo-Metaphorik speist. Simultan formiert sich ein schwarzes Subjekt, in dessen Kern sich Mythos und Magie verschränken, um mithin die Basis jenes Rationalismus in Frage zu stellen, auf der das aufklärerische Subjekt fußt. Und mehr noch: Indem sie der westlichen Rationalität das Irrationale gegenüberstellt, entlarvt die Strategie des Afrofuturismus sowohl sich selbst als auch das Projekt der Aufklärung als Wissensstrukturen, die einer jeweils eigenen, ihnen inhärenten Logik folgen. Mit dieser Erkenntnis bröckelt allerdings der immanente Universalitätsanspruch aufklärerischen Denkens unter der Last eines mit Mitteln der Rationalität nicht zu legitimierenden Rassismus.
Als in den frühen Stadien des Kalten Krieges in den 1950er Jahren zwischen Amerika und der Sowjetunion das Wettrüsten um die Kolonialisierung des Weltalls (das sogenannte Space Race) ausbricht, trägt die auf der Erzählung technologischen Fortschritts basierende Aufbruchseuphorie auch auf kultureller Ebene Früchte. Plötzlich öffnet sich der begrenzte Horizont irdischen Denkens hin zur Unendlichkeit, zum Potentiellen und Spekulativen — also hin zu jenen Gespenstern der Verheißung einer fernen Zukunft, die es nun mit Hilfe technologischer Innovationen zu erobern gilt. Zur selben Zeit avancieren Radio und Fernsehen zu Massenmedien und lösen sowohl Bild als auch Ton vom Ursprung ihrer Entstehung ab. Das rückt gleichermaßen neue, technologievermittelte Formen der Subjektivität in den Rahmen des Denkbaren. 1952 erscheint Ralph Ellisons Science Fiction-Roman Invisible Man, der die Geschichte eines Afroamerikaners auf der Suche nach der eigenen Identität außerhalb der Bilderwelten weißer Imagination erzählt. Ellisons Protagonist entdeckt sie schließlich in der Auflösung des Körpers in Sound und Licht. Elektrisch verstärkt und über fünf Radioapparate multipliziert, schießt sein Astralleib im Gewand von Louis Armstrongs Stimme mit Lichtgeschwindigkeit durch die New Yorker Unterwelt. Hier wird en passant ein weiteres wesentliches Unterscheidungsmerkmal zwischen weißer und afroamerikanischer Subjektivität deutlich: Während westliche Konzepte vor allem vermittels der sinnstiftenden Kraft des Sichtbaren (Schrift und Bild) funktionieren, schöpft ihr Widerpart ein Gros derselben aus dem Akustischen. Bereits Du Bois erkannte in der Musik das Wesen der schwarzen Seele — jenen verweigerten Baustein, der den schwarzen Leib auf die Stufe des Menschlichen hätte heben können.
Ellisons Invisible Man steht also einerseits prototypisch für die Faszination der Afrofuturisten mit den Potentialen der Technologie ein, artikuliert darüber hinaus jedoch ein fundamentales Befreiungsmoment: Eine Idee von Subjektivität, die nicht mehr der Rassen-Determinante samt deren Indizes von Körper und Stimme verhaftet bleibt. In ihrem Kern verkettet sich das Magische der schwarzen Seele mit der potenzierenden Wirkungskraft der Technologie zu einer Art posthumanen Hybride, die Alexander Weheliye ›hypersoul‹ nennt. (8) Eine derartige Konzeption von Subjektivität betont das Ephemere, Schwerelose und vor allem auch Wandelbare, um mithin den Begriff selbst von dessen symbolischer Verdichtung auf den weißen Körper zu befreien. Im selben Atemzug stellt sie unterschwellig den westlichen Anthropozentrismus in Frage. Über die Ablösung der Subjektivität vom Körper werden überdies Alter-Egos möglich, wie sie beispielsweise Kool Keith in Form von ›Dr. Octagon‹, ›Black Elvis‹ und ›Dr. Doom‹ oder Parliament mit ›Dr. Funkenstein‹, dem ›Lollipop Man‹ und den ›Extraterrestrial Brothers‹ erschufen. Noch präziser als Alter-Egos trifft es allerdings ein Begriff des britischen Kulturkritikers Kodwo Eshun: ›Multi-Egos‹ (9) — denn als gänzlich artifizielle Charaktere bilden sie keine Variationen eines originären Ichs mehr, sondern eigenständige, frei flottierende Subjektivitäten. Frei nach Vilém Flusser: das Subjekt wölbt sich nach Außen und wandelt sich in diesem Zuge zum Projekt. (10) So betrachtet, fungieren diese Multi-Egos gleichsam als Projektionen, geisterhafte Erscheinungen einer Utopie, die sich am Leitfaden technologischer Entwicklung auf eine post-rassistische, post-humane (insofern ›human‹ auf das Menschenbild westlicher, aufgeklärter Gesellschaften abzielt) und post-identitäre Gesellschaftsform zubewegen. An dieser Stelle verbirgt sich auch der grundlegende Unterschied zu Bewegungen des ›Black Nationalism‹: Während letztere um das afroamerikanische Äquivalent weißer Subjektivität kämpfen, stellt der Afrofuturismus das Konzept zur Gänze in Frage. Das macht ihn gleichsam zum Politikum, denn insofern über den Mittler des Subjekts Identitäten und damit immer auch Ausgrenzungen produziert werden, sind diese machtpolitisch gegeneinander ausspielbar. Im Namen der afrofuturistischen Utopie gilt es also, so ein Bonmot von Antonio Negri und Michael Hardt, »an der Abschaffung der eigenen Identität zu arbeiten« (11).
› You’re dead — Klänge der Verheißung ‹
Versatzstücke dieser afrofuturistischen Denkart lassen sich auf mehreren Ebenen und in einer Vielzahl der Brainfeeder-Releases entdecken. Im vergangenen Jahr erschien mit You’re Dead das fünfte Flying Lotus-Album. Das zugehörige Artwork konzipierte der japanische Mangazeichner Shintarō Kago, dessen künstlerische Sujets sich üblicherweise zwischen Psychose, Körpermodifikation und Pornographie bewegen. Demgemäß entwarf er auf der Innenseite der Doppel-LP–Ausgabe eine auf den ersten Blick äußerst makabre Szenerie: Dort türmt sich ein schier unüberschaubares Meer an Körpern, die allesamt in einem mal mehr, mal minder ausgeprägten Stadium der Verstümmelung begriffen sind. In der Mitte des Horizonts thront in riesenhafter Gestalt eine Art afro-hinduistische Gottheit. An Stelle ihres Gesichts oder vielmehr dort wo sich dessen Identitätsmarker (Augen, Nase, Mund) befunden hätten, liegt bezeichnender Weise ein Schwarzes Loch. Von ihm geht ein unheilvoller Sog aus, der die fragilen Körper nach und nach zerfasern lässt. In der Drastik der Bildersprache manifestiert sich eine kraftvolle Endzeit-Allegorie. Neben der pointierten Darstellung blutigen Grauens im Diesseits artikuliert sie obendrein jedoch ein ähnliches Befreiungsmoment wie Ellisons Invisible Man. Denn jenes Schwarze Loch erscheint in der Darstellung gleichsam als friedvoller Fluchtpunkt (des Szenarios). Es eröffnet den Blick auf ein – wenngleich nicht näher bestimmtes – Jenseits des Körpers einschließlich der ihn formierenden Schichten aus Subjektivität und Identität. Das Grauen erscheint zudem nur dann als grauenhaft, wenn der Körper als wertvoll bestimmt ist.
Auch im Cover-Artwork zu Kamasi Washingtons The Epic lassen sich Fragmente entdecken. Es zeigt ihn in einer Art Kalasiris, einem altägyptischen Hemdgewand, nebst Saxophon vor dem Hintergrund eines ideellen Abbilds zweier Planeten. Während sich aus dem Symbolcharakter der Kleidung der Referenzrahmen einer prähistoriografischen Gesellschaft lesen lässt, ist es einerseits die Weltraum-Ikonografie des Hintergrunds, in deren Darstellung fremder Planeten sich bis heute die Idee des Zukünftigen artikuliert und andererseits die besondere Betonung des Saxophons – die ausgestellte Eleganz der filigran gearbeiteten Mechaniken, die makellose Geschwungenheit des Metalls –, die vielmehr auf die technologische Ausgefeiltheit des Instruments denn dessen musikalische Eigenschaften abzielt. In den Händen Washingtons wird es zum prosthetischen Vehikel: Es befreit die Stimme vom semantischen Gewicht der Sprache und des sprechenden Körpers, um so die Kraft des unverfälschten Ausdrucks zu potenzieren.
Obendrein offenbart sich in dieser scheinbar widersprüchlichen Montage von Symbolen der Vergangenheit und Zukunft eine weitere Besonderheit: Das Zeitverständnis der Afrofuturisten konterkariert das lineare Fortschrittsdenken westlicher Gesellschaften mit Hilfe einer parallelen Auffassung von Zeit, in der sich Gegenwart als momentanes Zusammenfallen von Vergangenem und Zukünftigem äußert. Damit bleibt sie immer auch einem Stadium der Flüchtigkeit verhaftet, worin sich einerseits eine Art Verdrängungsmechanismus erkennen ließe, in dem gegenwärtige Erfahrungen sozialer Ungleichheit samt deren mitunter schmerzhaft realen Auswirkungen als temporär verklärt und mithin nicht vollends anerkannt werden. Gleichwohl eröffnet der theoretische Rahmen dieses Konzepts von Zeitlichkeit auch die Möglichkeit der Bewältigung des ›Founding Trauma‹ (Kodwo Eshun) kultureller Entwurzelung. John Akomfrahs Video-Essay The Last Angel Of History verbildlicht das in der Figur des ›Data Thief‹: In einem übergeordneten Erzählstrang springt der ›Data Thief‹, eine Art afroamerikanischer Archäologe aus der Zukunft, ausgestattet mit einer Spezialbrille, die ihn verschollene Relikte der eigenen Kultur erkennen lässt, durch verschiedene Epochen der Zeitgeschichte, um so die fragmentierten Ursprünge der eigenen Herkunft rekonstruieren zu können. Dieses Zeitverständnis hallt auch auf der Ebene des Musikalischen wieder. Denn im Gegensatz zum schablonierten Ablauf des (proto-)typischen Pop-Songs zeichnen sich viele Brainfeeder-Tracks (beispielsweise Flying Lotus’ Cold Dead, Kamasi Washingtons Change Of Guard oder auch Thundercats Lotus And The Jondy) durch einen chaotischen Drang zur Beschleunigung aus, in dessen Verlauf sich die Klangmaterie immer weiter verdichtet, um schließlich in einer orgiastischen Explosion aufzugehen, die sämtliche Bestandteile des Tracks im Raum versprengt. Die Musik funktioniert gewissermaßen über partikulare Verdichtungen und Expansionen der Zeit, die sich in organischen Kontraktionen der Sounds oder, wie es der Medienphilosoph Frank Hartmann treffend formulierte, »Vibrationen des Atmosphärischen« (11) äußern. Vor allem Flying Lotus-Alben folgen auf ganzer Länge häufig einer Art Urknalllogik, da auf diese chaotischen Eruptionen in aller Regel Interludes relativen Stillstands folgen.
Ein weiteres zentrales Terrain auf dem sich die afrofuturistische Sensibilität äußert, liegt nicht zuletzt in der Stimme, gilt sie doch – zusammen mit dem Körper – als Signum der Identität. Im klanglichen Universum von Thundercat finden hier gleichsam die Gespenster Zuflucht: Sie offenbaren sich als Stimmen ohne Körper. Besonders deutlich wird das beispielsweise in Hard Times. Hier artikuliert sich das Verwirrspiel mit der Identität auf zweierlei Arten: Einerseits auf inhaltlicher Ebene, wenn es im Liedtext heißt:
I can’t feel my face
Where’s this cold, dark place?
This must be the end
Time to shed some skin
The moon brings high tide in
Rotting and wasting away
Transform this decaying flesh
Mumm-Ra the Ever-Living
God give me sight beyond sight
In der Rahmung des Tracks entsteht hier ein fiktionaler Ort, an dem das erzählende Ich als eine Art Leibniz’sche Monade oder seelische Essenz in einem Moment der Abspaltung oder Transformation von dessen leiblicher Hülle porträtiert wird. Der Mumm-Ra–Charakter referiert dabei auf eine der Hauptfiguren aus Marvels 80er Jahre Comic-Serie Thundercats, in dessen Alien-Körper sich die vier ›Ancient Spirits of Evil‹ offenbaren. Seine Spiegelung findet dieses Moment der Transformation auch auf formaler Ebene in einer Stimme, die sich ob ihres androgynen Timbres keinem, innerhalb der heterosexuellen Matrix verortbaren, Körperbild mehr zuordnen lässt. Dieser Effekt wird durch die Konstruktion eines Hallraums noch zusätzlich verstärkt — er lässt die Stimme wie schwerelos erscheinen.
› Black To The Future ‹
Die besondere Bedeutung eines Labels wie Brainfeeder (oder vielmehr der im Labelkatalog versammelten Künstler) in der gegenwärtigen Poplandschaft generiert sich also aus einer schmerzhaften Getriebenheit: Während die Geister der Vergangenheit unaufhaltsam drohen die Musik zu infiltrieren, versucht sich dieselbe immer neue Fluchtorte zu schaffen. Folgt man den Spuren durch den immensen Referenzdschungel von Comic-, Film-, Videospiel-, Literatur- und natürlich Musikanleihen, entsteht ein – insbesondere für westlich geprägte Augen – außergewöhnliches Bild der Genese afroamerikanischer Kultur: Sie selbst ähnelt einem jener Science Fiction-Szenarios aus den Romanen, die sie zitiert. Außerirdische Entführungen und Strafkolonien auf fremden Planeten sind keine dystopischen Horrorvisionen, sondern bereits durchlebte Realität einer ganzen Bevölkerungsgruppe. Die Schreckgespenster dieser Erfahrung prägen noch heute die gesellschaftliche Wirklichkeit der afroamerikanischen Diaspora, bewirken jedoch zugleich einen Hunger nach Zukunft — das Verlangen nach einer Utopie, die dem Phantomschmerz Linderung verschafft, indem sie die Schattenseiten der Vernunft thematisiert, um sie überwinden zu können. Dieser Hunger ist für Flying Lotus, Kamasi Washington, Ras G und Co. gleichsam Treibstoff, mit dem tradierte musikalische Muster aufgebrochen werden, um Räume für wilde Spekulationen zu schaffen, das kreative Potential des Chaotischen einfallen zu lassen und darüber hinaus auch verhärtete Denk- und Wissensstrukturen innerhalb unserer Kultur zu lösen. Ein produktives Chaos, dessen visionärer Charakter die Beengtheit des Irrgartens für die endlose Weite des Kosmos öffnet.
Text
Robert Henschel
Fotografie
© Mike Park
[togglegroup][toggle title=“Quellen“]
(1) DERRIDA, Jacques (1995): Marx’ Gespenster. Der verschuldete Staat, die Trauerarbeit und die neue Internationale. Frankfurt a. M.: Fischer. S. 253.
(2) BERARDI, Franco ›Bifo‹ (2011): After the Future. Oakland, CA: AK Press.
(3) FISHER, Mark (2015): Gespenster Meines Lebens. Berlin: Edition Tiamat. S. 26.
(4) DERY, Mark (1994): Black To The Future: Interviews With Samuel R. Delaney, Greg Tate And Tricia Rose. In: Ders.(Hg.): Flame Wars. The Discourse Of Cyberculture. Durham, NC: Duke University Press.
(5) WEHELIYE, Alexander (2002): ›Feenin‹: Posthuman Voices in Contemporary Black popular Music. In: Social Text, 20,2. S. 28. eigene Übersetzung.
(6) DU BOIS, W.E.B. (1997 [1903]): The Souls Of Black Folk. Boston: Bedford Book.
(7) BENJAMIN, Walter (1991): Über den Begriff der Geschichte. In: Ders. Gesammelte Schriften. Bd. 1. Herausgegeben von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. S. 696.
(8) WEHELIYE, Alexander (2003): ›I Am I Be‹: The Subject of Sonic Afro-Modernity. In: Boundary 2, 30,2. S. 97-114.
(9) ESHUN, Kodwo (1999): Heller Als Die Sonne. Berln: ID Verlag. S. 30.
(10) FLUSSER, Vilém (2008): Digitaler Schein. In: Ders.: Medienkultur. Herausgegeben v. Stefan Bollmann. Frankfurt a. M.: Fischer. S. 213.
(11) HARDT, Michael; NEGRI, Antonio (2010): Common Wealth. Das Ende des Eigentums. Frankfurt a. M./New York: Campus. S. 339.
(12) HARTMANN, Frank (2003): Instant Awareness. Eine Medientheoretische Exploration mit McLuhan. In: Marcus S. Kleiner; Achim Szepanski (Hg.): Soundcultures. Über elektronische und digitale Musik. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. S. 51.
[/toggle][toggle title=“Diskografie“]
Algiers (2015). ›Algiers‹. Matador Records — OLE 1067-2
D’Angelo And The Vanguard (2015). ›Black Messiah‹. RCA — 88875-05655-2
Flying Lotus (2014). ›Cold Dead‹. Auf: You’re Dead. Brainfeeder/Warp Records — WARPLP256
Ras G & The African Space Program (2013). ›Back On The Planet‹. Brainfeeder — BFCD039
Thundercat (2013). ›Lotus And The Jondy‹. Auf: Apocalypse. Brainfeeder — BF040
Thundercat (2015). ›Hard Times‹. Auf: The Beyond/Where The Giants Roam. Brainfeeder — BFDNL055
Washington, Kamasi (2015). ›Change Of Guard‹. Auf: The Epic. Brainfeeder – BFCD050
[/toggle][toggle title=“Videografie“]
Akomfrah, John (1996): The Last Angel Of History. New York: Icarus Films.
Mugge, Robert (1998): Sun Ra: A Joyful Noise. New York: Winstar.
[/toggle][toggle title=“Hör|Spiel“]
[/toggle][/togglegroup]