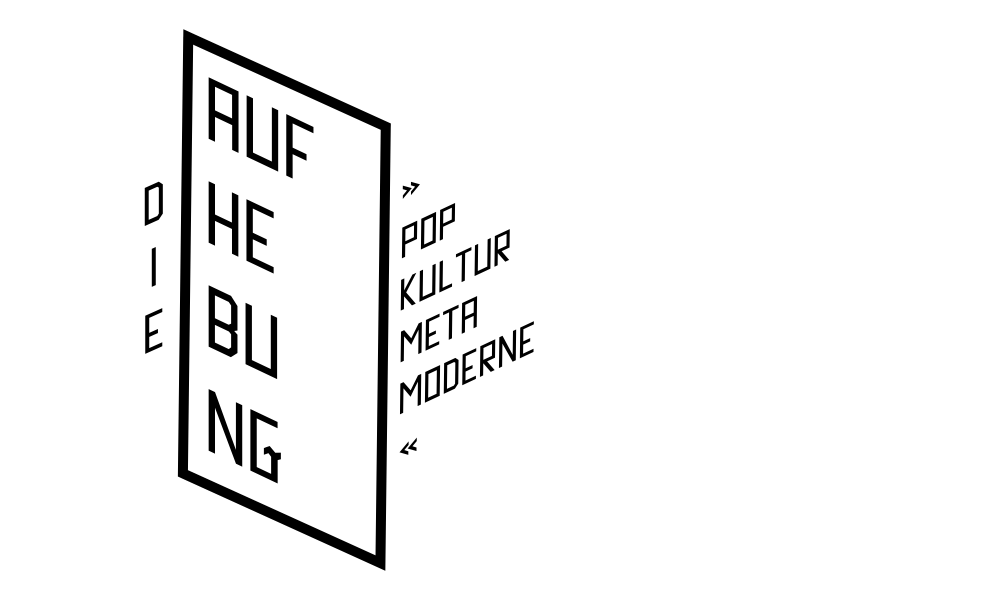Es geschieht selten, dass Musik und Philosophie einander auf Augenhöhe begegnen. Philosophen, die sich der modernen Musik annahmen, lassen sich zwar ohne Weiteres aufspüren — Schopenhauer gehörte zu ihnen, Nietzsche auch und nicht zuletzt Adorno. Was aber hieße es, den Spieß umzudrehen und nicht von einer Philosophie der Musik sondern einer Art musikalischen Philosophie zu sprechen? Einer dieser raren Kollisionsmomente zwischen Klingen und Denken verdichtet sich in der Idee des Synthesizers. Die historische Entwicklung des Instruments lässt sich entlang polyphoner Klassiker wie dem ARP Odyssey oder Yamahas CS80 bis zu deren monophonen Vorfahren und mithin den Pionieren des Instruments, Robert Moog und dem erst kürzlich verstorbenen Don Buchla, gut zurückverfolgen. In der Philosophie müsste man wohl Kant als Urvater des Synthesizers anführen. Für ihn synthetisierte der Verstand das Material der Erfahrung zum einheitlichen Bild der Wirklichkeit. Und in dessen Folge natürlich Hegel, der die Synthese als Aufhebung des Widerspruchs von These und Antithese dachte. Beide Ströme des Synthesizers – gedanklich und klanglich – laufen schließlich bei Gilles Deleuze zusammen. Für ihn symbolisierte das Instrument den Entstehungsprozess des Klangs: Ein Prozess, der in Mikro-Intervallen einzelne Klang-Moleküle aneinander knüpft und an dessen Ende schließlich die hörbare Schwingung steht. Das Denken operiert in diesem Konzept letztendlich in der gleichen prozessualen Logik wie auch das Klingen.
Als Deleuze diese Überlegungen zusammen mit seinem Landsmann, dem Psychoanalytiker Félix Guattari, in Tausend Plateaus (1993) niederschrieb, war Richard Pinhas bereits 42 Jahre alt und hatte 13 Alben veröffentlicht, sieben mit seiner Mitte der 70er Jahre gegründeten Band Heldon und sechs unter seinem eigenen Namen. 16 Jahre zuvor, noch als Student unter Deleuze, hatte er einen Text zu den Potentialen des Synthesizers im Pop verfasst, der es bis in eine der Fußnoten zu Tausend Plateaus schaffte. Überhaupt war das Verhältnis, das der Musiker und der Philosoph bis zu dessen Lebensende im Jahre 1995 pflegten, sehr vertraut. Wo Deleuze die Einsichten, die Pinhas aus seinen Synthesizer-Experimenten und jenen von Robert Fripp und Brian Eno zog, in sein Denken fließen ließ, dort setzte Pinhas an, um die Inspiration durch dieses Denken wiederum in Sound zu übersetzen — Input/Output lautete damals der Titel seiner Publikation. Pinhas’ Musik, ob mit Heldon oder Solo, bewegt sich vor allem zwischen zwei Polen: Gelegentlich ist sie von in Richtung Noise driftenden Gitarrenklängen beherrscht, deren besonnenen Gegenpol sphärige Synthesizer-Experimente bilden. Gerade erschienen mit Mu und Process And Reality Pinhas’ inzwischen 27. und 28. Soloalbum auf Cuneiform Records. Ein Gespräch über Philosophie, Musik und Science Fiction.
Sollen wir mit der Philosophie beginnen? Das scheint mir eines der wichtigsten Themen in Ihrer Musik zu sein.
Sehr gern.
Was glauben Sie, in welchem Verhältnis stehen Philosophie und Musik?
Bevor ich mich damals gänzlich der Musik zuwandte, studierte ich Philosophie und arbeitete dabei mit Jean-Francois Lyotard und Gilles Deleuze. Nachdem ich schließlich meine Dissertation abgeschlossen und ein knappes Jahr lang unterrichtet hatte, wurde es langweilig und ich entschied mich für die Musik. Das Interesse an der Philosophie ist aber nie gewichen. Die zentralen philosophischen Konzepte, um die meine Musik kreist, beschäftigen sich vor allem mit dem Gegenstand der Zeit: Ereignis, Wiederholung, Differenz und Dauer. Diese Konzepte bilden wesentliche Elemente in den Philosophien von Whitehead, Spinoza, Deleuze oder auch Foucault. In der Physik spielen sie vor allem in der Loop-Theorie eine Rolle und nicht zuletzt natürlich in der elektronischen Musik. Und zwar in dem Sinne, dass eine Wiederholung eine unbestimmte Zahl an weiteren Wiederholungen definiert. Das Ereignis und die Veränderung entspringen derselben Idee. Wenngleich Musik obendrein eine Spur von Seele und Hirn braucht [lacht]. Vielleicht könnte man sagen, dass diese vier Begriffe einen Raum eröffnen, in dem sich Klang und Konzept im Prozess begegnen. Mit dieser Begegnung beschäftigten sich zum Beispiel Event And Repetitions (2002) und auch Process And Reality (2016) — ein Titel der auf Alfred North Whitehead zurückgeht, einen Philosophen, den Deleuze sehr schätze.
Warum war es gerade Deleuzes Philosophie, die Sie ansprach?
Ich war damals noch ziemlich jung. In erster Linie war es der Gedanke, dass sich aus der Zusammenarbeit mit ihm eine Freundschaft entwickeln könnte — was letztendlich auch geschah. Von 1971 an bis zu seinem Tod habe ich seine Arbeiten aufmerksam verfolgt und nicht zuletzt an einigen Seiten von Tausend Plateaus mitgearbeitet. Deleuze war sehr am Synthesizer interessiert, eine Inspiration, die er aus Kants Idee der Synthesis zog. Ich habe ihn damals zu einem Konzert von Robert Fripp mitgenommen, in dem er seine Frippertronics vorführte, um zu zeigen, wie nah sich repetitive Musik und seine Philosophie standen. Ich glaube, dass Deleuzes Denken eine der großen Errungenschaften der Philosophie des 20. Jahrhunderts ist. Für mich war sie, neben dem Einfluss von Nietzsche, ein äußerst prägendes Element.
Wie übersetzen Sie diesen theoretischen Hintergrund in Musik?
Meine Musik ist vor allem vom Experimentieren mit dem Klang-Prozess geprägt. Also der Frage, wie sich aus einzelnen Ereignissen und deren Wiederholung Klanglandschaften formen lassen. In der Arbeit mit Yoshida [Tatsuya, auf Welcome To The Void (2014)] äußerte sich dieser Prozess in der gegenseitigen Beeinflussung zwischen Schlagzeug und Musik. Dort kann man ihn fühlen, hören und – das hoffe ich zumindest – unmittelbar verstehen. Ich glaube allerdings, dass man dieselbe Musik auch ohne philosophische Lektüre machen kann. Bei mir ergab sich das schlichtweg.
Haben Sie diesen philosophischen Hintergrund im Kopf, wenn Sie ihre Musik aufführen oder aufnehmen?
Nein. Musik, Philosophie und auch Literatur sind ein essentieller Bestandteil meines Lebens, sie sind so etwas wie der Grundton, der allem, was ich tue, unterliegt — der Art und Weise meines Gitarrenspiels und natürlich auch meiner Art des Denkens. Ich stehe nicht auf der Bühne, um den Klang eines Konzepts zu erzeugen, im Sinne von: Jetzt müssen x Wiederholungen folgen. An diesem Punkt ist alles offensichtlich. Falls es das nicht ist, dann bin ich nicht bereit.
Es gab mal einen Text über Deleuze und Pop, der den Titel What I Hear Is Thinking Too trug: Was ich höre, das ist gleichsam das Denken. Gibt es eine Analogie zwischen Gehörtem und Gedachtem?
Den Text selbst kenne ich nicht. Aber ich glaube, dass es keine Form der Analogie ist, sondern vielmehr ein und derselbe Prozess. In meinem Verständnis ist es direkt und ohne Vermittlung das Gleiche. Der Output mag unterschiedliche Formen annehmen, aber im Verstand gibt es da keinen Unterschied.
Sie haben gerade schon die Literatur angesprochen; viele ihrer Alben beziehen sich mehr oder weniger direkt auf Science Fiction-Literatur. Chronolyse (1978) zum Beispiel war eine Hommage an Frank Herberts Dune-Romane. Wie kam diese Verbindung zustande?
Meine erste Begegnung mit Science Fiction fand Anfang der 70er Jahre statt. In etwa zur selben Zeit mit zwei verschiedenen Romanen: Philip K. Dicks Ubik (1969) und Norman Spinrads Bug Jack Barron (1969). Vier Jahre später hatten meine damalige Freundin und ich das große Glück, einen Tag mit Philip K. Dick und Norman Spinrad in Los Angeles verbringen zu dürfen. Das war ein sehr eindrucksvolles Erlebnis. Ich bin der Meinung, dass Dick einer der letzten Propheten ist — in einem durchaus biblischen Sinne. Zu Norman Spinrad, der zeitweise in Paris gelebt hat, habe ich noch immer ein sehr enges Verhältnis, gelegentlich arbeiten wir noch zusammen. Und die dritte wichtige Begegnung war schließlich Maurice Dantec, der leider vor Kurzem verstarb. Anfang der Nullerjahre hatten wir gemeinsam das Schizotrope-Projekt gegründet. Inzwischen hat sich der Einfluss eher zu Romanen abseits der Science Fiction verschoben, aber zu Beginn der 70er Jahre war er sehr stark.
Wie äußerte sich das in Ihrer Musik?
Vor allem die Anfänge mit Heldon und meine ersten Solo-Alben zogen viel Inspiration daraus — Frank Herberts Dune ist da ein gutes Beispiel. Eine sehr direkte Inspiration zudem, denn die Weltentwürfe, die Philip K. Dick, Norman Spinrad und Maurice Dantec beschrieben waren ja letztendlich Visionen unserer eigenen Welt. Ich betrachte Science Fiction ähnlich wie Philosophie: Als eine bestimmte Art des Denkens und als Möglichkeit die Menschen anzuregen, sie zu affizieren, wie Deleuze wohl gesagt hätte.
Denken Sie, dass in diesem Affekt auch ein politisches Potential steckt? Unter anderem Desolation Row (2013) und Welcome In The Void (2014), zwei Teile der Devolution-Trilogie, waren ja sehr vom gegenwärtigen Weltgeschehen geprägt.
Ich bin mir sicher, dass Musik das affektive Potential hat, um die Lebensrealitäten von Individuen und vielleicht auch kleinere Gruppen zu beeinflussen. Das macht sie für den Einzelnen so wichtig. Allerdings glaube ich nicht, dass es auf einer größeren Skala funktionieren würde. Wir brauchen vielmehr eine andere Gesellschaftsform, in der Musik eine integralere Rolle spielt. Aber bevor dieser Schritt vollzogen ist, werden noch 20 oder 30 strapaziöse Jahre vergehen müssen. Strapaziös im ökonomischen Sinne: Wir werden extreme Armut — in Frankreich liegt die Arbeitslosenquote bereits jetzt bei 20 Prozent – und Bürgerkriege erleben, nicht nur fernab des europäischen Festlands, sondern zusehends auch in unseren hiesigen Gesellschaften. Die Ansätze sind ja inzwischen unverkennbar. In Frankreich bleibt lediglich die Wahl zwischen einer Rechten und einer extremen Rechten, während die Linke der gegenwärtigen Situation völlig hilflos gegenüber zu stehen scheint. Desolation Row war als eine Art Kommentar gedacht, eine musikalische Vision unseres gegenwärtigen Lebensstils. Ein verhängnisvoller Einblick in den Zustand der Gegenwart, die geprägt ist von Migration und einer Idee des Menschen, der sich zusehends zur biologischen Singularität entwickelt, getrieben vom Willen zum Konsum. Sofern wir diesen momentanen Zustand überwinden, sehe ich allerdings durchaus Besserung. Ich glaube, die Zukunft sieht sehr robotisiert aus. Und sie wird in der Stadt liegen, in der Verbindung von Städten, die Ländergrenzen letztlich irrelevant werden lassen.
Würden sie ihre Musik selbst als eine Art Science Fiction beschreiben?
Nein, nein. Mein Leben kreist vor allem um die Musik. In den 70er und 80er Jahren gab es da eine gewisse Nähe zur Science Fiction, die heute aber bei weitem nicht mehr so ausgeprägt ist. Sie ist natürlich nicht gänzlich verschwunden, ebenso wenig wie die philosophischen Konzepte oder auch Romane und Frauen. Das sind Prägungen, die in irgendeiner Form immer mitschwingen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Interview und Text
Robert Henschel
Titelbild
© Cuneiform Records
[accordiongroup][accordion title=“Hör|Spiel“]
[/accordion][/accordiongroup]
[notification type=“success_alert“ title=““]Eine gesammelte Neuauflage der Diskographie Richard Pinhas‘ erscheint sukzessive auf Cuneiform Records. Bereits im Januar 2017 erscheint unter dem Titel Reverse das nächste Album — mit Bureau B zudem erstmals auf einem deutschen Label.[/notification]