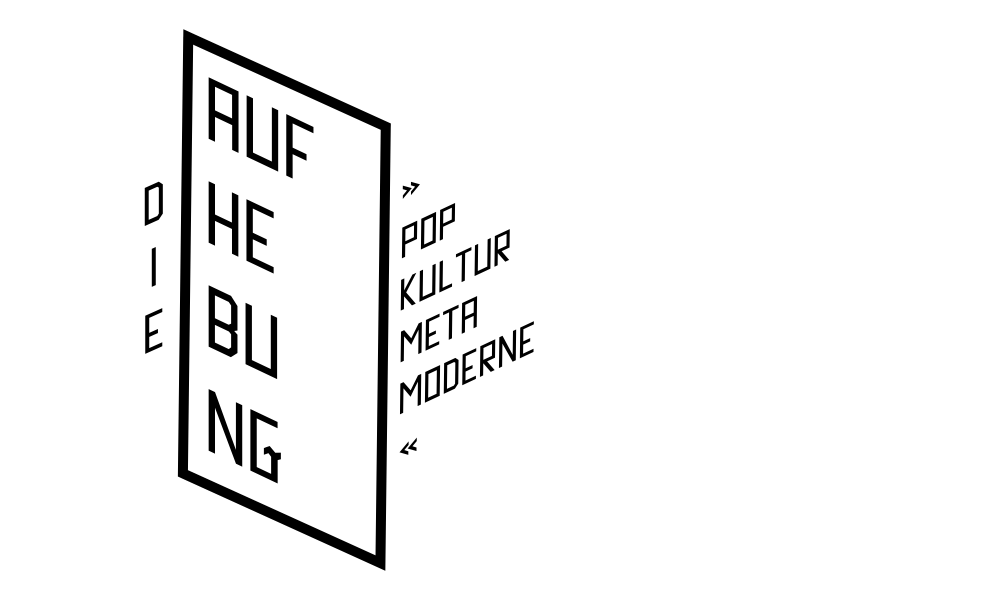Das Pressefoto wirkt wie aus einer Calvin Klein-Kampagne geklaut. Verlassen und mit dieser eigenwilligen Mischung aus Melancholie und erratischem Sexappeal in den Gesichtszügen steht James Harmon Stack vor einer frisch verputzten Hauswand. Er blickt auf die Boots mit denen er im Dreck scharrt, das T-Shirt zu groß, hängender Kopf, Körperspannung auf ein für das Überleben notwendige Mindestmaß heruntergefahren. Das Bild ächzt unter dem Gewicht des auf ihm lastenden Grauschleiers, scheint aber ganz zufällig geschossen. Eine vollkommen absurde Situation, die jedoch wie ein perfekt austariertes Abbild von Stacks emotionalem Innenleben funktioniert — eine Art Psychografie.
Umso adäquater ist der Titel des Debütalbums gewählt: ›Tell Me I Belong‹. Denn in der Tat haftet der Platte streckenweise eine etwas klebrige Coming-Of-Age–Patina an. In solchen Momenten trumpfen hymnische Vokalsamples auf, die pathostrunkene Adoleszenzgeschichten à la »so weak … inside of you« erzählen (›Without‹). Been there, done that. Soweit so unspektakulär. Und doch erweckt etwas den Eindruck, als würde die theatralische Geste zwanghaft versuchen ein viel fragileres Moment zu übertünchen. Als ob nach dem Rave nichts als die standardisierte Anonymität des Hotelzimmers warten würde. Eine zum Hintergrundrauschen des Lebensalltags geronnene Haltlosigkeit, der man mit exaltiertem Ausgehen begegnet. Irgendwie zeitgemäß. Diese Schizophrenie zieht sich wie ein roter Faden durch die knappe halbe Stunde, die während der zehn Tracks vorbeirauscht.
»Es gibt ein großes und doch ganz alltägliches Geheimnis. Alle Menschen haben daran Teil, jeder kennt es, aber die wenigsten denken darüber nach. Die meisten Leute nehmen es einfach so hin und wundern sich kein bisschen darüber. Dieses Geheimnis ist die Zeit.« hieß es in Michael Endes ›Momo‹. Jim-E Stack wundert sich, mit dem Effekt eines diffusen Gefühls der Zeitlosigkeit, das einen – anders als im Techno – die bohrende Gewalt der tickenden Zeiger verspüren lässt; was jedoch von Sekunde zu Sekunde an Kontur verliert ist das Ziffernblatt — chronometrischer Leerlauf (›Everything To Say‹). Bis sich nach einer Weile der Produktivitätsgedanke klammheimlich einschleicht und dieses gedankenverlorene Dösen mit unerbittlicher Wucht zu rationalisieren sucht. Dann meißeln knochentrockene 2-Step-Beats jedem noch so unscheinbaren Fluchtmoment die Feierlogik in die Hirnwindungen (›Reassuring‹). Mit – und das macht den Reiz von ›Tell Me I Belong‹ aus – mäßigem Erfolg. Vielmehr bleibt ein hypernervöses Hin-und-Her als Status quo bestehen, was der Platte – allem subkutan melancholischen Tenor zum Trotz – eine durchaus produktive Grundanspannung einschreibt, die weder große Gesten noch hippe Grauschleier zu kaschieren vermögen.
Text
Robert Henschel
Fotografie
© Tailored Communication
[tabgroup][tab title=“Hör|Spiel“][/tab][/tabgroup]
[notification type=“success_alert“ title=““]›Tell Me I Belong‹ erscheint auf Innovative Leisure.[/notification]