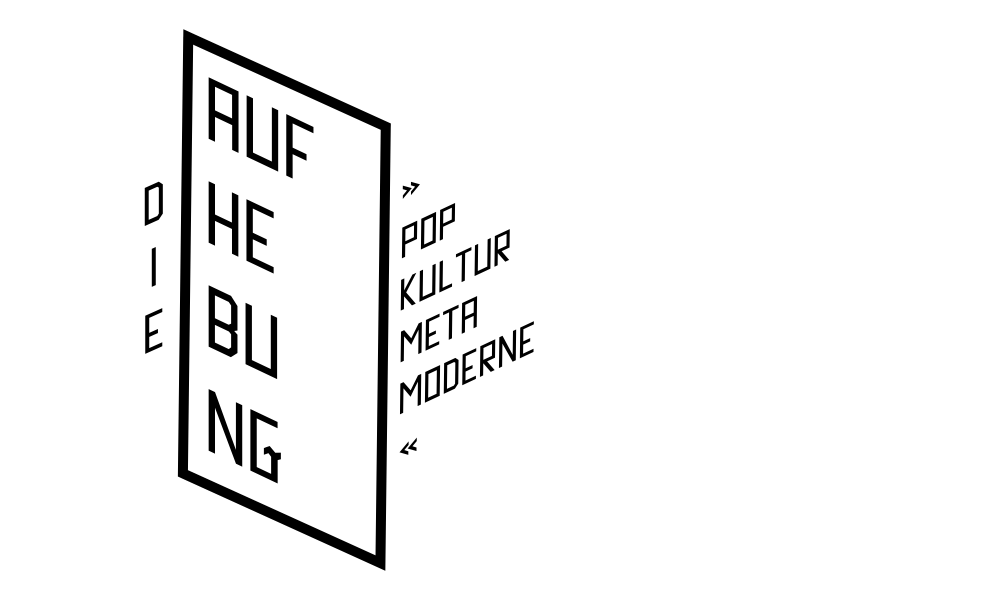Nach der Mimesis – die Simulation.
— Frank Hartmann
Kunst ist besser als Wahrheit.
— Vilém Flusser
Dicke Nebelschwaden durchziehen das Auditorium des Casa Das Mudas Art Centre. Begleitet vom leisen Zischen der Nebelmaschine betreten nach und nach die ersten Gäste den Saal. Die Bühne ist spartanisch bestückt — lediglich die Umrisse von einigen mannshoch aufeinander getürmten Boxen, ein Malertisch, Laptop, Mischpult und die aus dem Hintergrund illuminierte Silhouette eines hager wirkenden Lawrence English sind im Dunst erkennbar.
Dann beginnt es. Ein erster Schwall Töne ergießt sich in den Raum, oder ist vielmehr ganz unvermittelt da, so als hätte er die bis eben noch ruhende Klangkulisse mit einem Handstreich vom Tisch gefegt, um sie gleichsam zu ersetzen — seltsam formlos und dünnhäutig bewegt er sich, schwebt für eine Weile unter kaum merklichen Auf- und Abbewegungen vermeintlich auf der Stelle, bis er sukzessive in die Polster der Sitze sickert. Nicht nur in die Sitze, auch durch unsere Pullover, Hemden und Jacken hindurch, bis auf die Hautoberflächen der Körper. Noch im Versiegen begriffen, folgt ihm ein zweiter Stoß, diesmal dichter, tieffrequent, laut und nah. Unangenehm nah, fast so, als würden die Klangmoleküle nun in den Körper hineindiffundieren und dabei dieses unterschwellige Gefühl der Bedrohlichkeit das sie in sich tragen überall ablagern: In Lipidschichten, im Magen, im Puls, bis hinunter ins Zytosol, dem sie ihr Resonanzmuster einprägen. Eine weitere Woge mischt sich unter, etwas versöhnlicher diesmal, verwischt das Unbehagen, vermag es aber gleichwohl nicht, selbiges zur Gänze auszulöschen.
Es ist – der logisch diskret gedachten Abfolge der Töne zum Trotz – in ästhetischer Hinsicht kein Nacheinander, sondern eine Gleichzeitigkeit derselben, die sie zum diffusen Klang clustert. Sie resultiert teils daraus, dass die Kürze der Intervalle, in denen die Töne aufeinander folgen, die synaptische Reizschwelle unterläuft. Zudem ist die Dichte ihres Auftretens derart hoch, dass jeder Versuch akustischer Ausdifferenzierung von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Sobald diese Klangcluster die Anregung durch die Membran des Lautsprechers überwunden haben, scheinen sie unvermittelt Halt zu machen, sich höchstens noch in winzigen Nuancen um ein imaginäres Zentrum zu bewegen, ein Flirren, ähnlich einer fata morgana. Oder anders: Sie bewegen sich in einer Schallschnelle, die sie in der Trägheit unserer Wahrnehmung quasi-allgegenwärtig wirken lässt — »Vibrationen des Atmosphärischen« nannte das Frank Hartmann (2003:51) in Anlehnung an Marshall McLuhans Konzept der ›instant awareness‹. Derart türmt sich soundwave über soundwave, bis ein unermesslich komplexes Ineinander der Klänge den Raum füllt, oder vielmehr durchdringt, um ihn im selben Moment zu deformieren.
Interferenzen
Ein Teil des diffusen Unbehagens speist sich aus einer kognitiven Dissonanz: Was wir hören entspricht nicht dem was wir sehen — die Klangcollagen wie sie sich unserem Ohr darbieten, lassen keinen kausallogischen Rückschluss auf ihren Ursprung mehr zu. Mit Argusaugen könnte man sie vielleicht noch bis in die Mikrobewegungen der Finger, mit denen English behände am Pult schraubt, zurückverfolgen, doch spätestens dann verlören sie sich in den Untiefen der Algorithmen jenseits der Interfaces. Das führt in zweierlei Hinsicht zu erkenntnistheoretischen Problemen: Erstens in Bezug auf die Subjektkonstitution. Denn der Widerspruch zwischen Auge und Ohr ist nicht aufzulösen. Das Betrachten der Szenerie, des Performatorischen, liefert uns keine essentiellen Informationen für das Verständnis der Musik mehr, sondern läuft vielmehr ins Leere, verliert sich irgendwo im Dickicht der Nebelschwaden. Was bleibt ist eine Rivalität der Sinne, deren sinnstiftendes Gewicht sich folglich hin zum Hören verlagert — vielleicht gründet hier der Impuls des Augenschließens, der sich bei so vielen Zuhörer_Innen beobachten lässt: Komplexitätsreduktion der Sinneseindrücke. ›Problematisch‹ wird nun folgendes: das Ohr erkennt keine Objekte. Jedenfalls nicht in derselben Form, in der es das Auge vermag, nämlich in der Raum-Zeit. Aus dem Perspektivischen des Sehens lässt sich im Rückschluss der Sehende interpolieren; das ein Objekt vor einem Hintergrund betrachtende Subjekt. Noch Jacques Lacans ›Spiegelstadium‹ als Gründungsmoment der Subjektivität beruht auf dieser visuellen Rückversicherung des Selbst. Im Hören nun verliert sich die Perspektive, mit ihr schwinden die Fundamente des visuellen Raums und machen einem Klangraum Platz, der viel fluider, tendenziell unbegrenzt und in ständigem Umbau begriffen ist, mithin seine ureigene Zeit- und Räumlichkeit erschafft — in diesem Sinne sprach McLuhan (1960) vom ›Acoustic Space‹. In der Konsequenz werden wir – Gefangene der Gutenberg-Galaxis – unweigerlich mit der Frage konfrontiert: wer ist dieses Klang-Ich? Beziehungsweise, kann es überhaupt Subjektivität innerhalb der Rahmung des Klangs geben? Was, wenn nicht? Und was ist diese affektiv-emotionale Ergriffenheit, wenn nicht Sound-Werden des Körpers — ontologische Resonanz.
Das zweite Problem entsteht hinsichtlich des Sinn- oder Wahrheitsgehaltes dieser Musik, die nicht mehr mimetisch, also abbildend, funktioniert, sondern vielmehr simulatorisch. Ihr hintersteht keine in irgendeiner Form organisierte Transzendenz mehr, die es zu ent-decken gälte (beispielsweise eine Partitur, an die sich eine wie auch immer geartete Intentionalität des hier waltenden Klangkosmos rückbinden ließe), sondern einzig die eisige Immanenz des Codes, dessen sinnlich wahrnehmbare Ausformung (Simulation) sie ist.
Willkommen in der ›Sonic Reality‹
Vielleicht ist es an der Zeit, Vilém Flussers Gedanken zu digitalen Bilderwelten auch auf Sound zu applizieren, den Gedankensynthesizer anzuwerfen, um sie mit McLuhans ›Acoustic Space‹ zu modulieren. Ende der 90er Jahre veranlassten die neu aufziehenden Bildschirmmedien, allen voran der Personal Computer, den tschechischen Medienphilosophen zu ganz ähnlichen Überlegungen bezüglich einer sich im (postmodernen) Wandel befindlichen Subjektivität.
Mit Descartes erwächst im 16. Jahrhundert die analytische Geometrie zum privilegierten Erkenntnismodell der Moderne — die denkende Sache (res cogitans) erkennt die ausgedehnte Sache (res extensa) mit Hilfe formal-kalkulatorischer Methoden. Die darauf folgenden Jahrhunderte lassen sich, laut Flusser, über Newton und Leibniz als eine Ausdifferenzierung dieser Denkmodelle lesen, denen an einer immer präziseren, lückenloseren arithmetischen Darstellung von Phänomenen gelegen ist. Mit Hilfe von Differentialgleichungen lässt sich schließlich die gesamte Welt formalisieren, mithin lassen sich Modelle für alles Erdenkliche erstellen. Die Computer radikalisieren dieses Denken soweit, dass sie mit Hilfe eines einzigen Befehls – nämlich ›digitalisieren‹ – und zwei Zahlen sämtliche Phänomene kodifizieren können. Und über dieses reine kodifizieren hinaus eröffnen sie zudem die Möglichkeit, den derart generierten Code zu neuen Phänomenen zusammenzusetzen. Das veranlasste Flusser dazu, die analytische Trennung zwischen Realität und Virtualität (hier im Sinne von nach außen projiziertem Code) radikal in Frage zu stellen. Realität betrachtete er fortan als einen Gradienten der Streuung. Phänomene waren dementsprechend umso realer, umso dichter die komputierten Punkte gerafft waren, also umso undurchsichtiger ihre Künstlichkeit wurde. Einerseits bedeutete das eine radikale Verschiebung des Instrumentariums zum Erkenntnisgewinn von Logik hin zu Ästhetik und andererseits die zweifelsohne verstörende Schlussfolgerung, dass sowohl die wahrgenommene Welt als auch wir selbst nichts anderes als Punktkomputationen, verdichtete Möglichkeiten sein konnten. Diese Einsicht riss die Subjekt/Objekt-Dialektik der Aufklärung samt den ihr anhaftenden Idealvorstellungen von autonomem Subjekt und Individualität nieder, um sie durch eine spekulative und futurologisch orientierte Fassung zu ersetzen: »Der Mensch als Projekt [Hervorhebung R.H.], dieser formal denkende Systemanalytiker und -synthetiker, ist ein Künstler« (Flusser 2008:215). Der Mensch wird zum kreativen Bestandteil der wahrgenommenen Welt, weil er sie vermittels der eigenen Wahrnehmung formt — in diesem Sinne ist er Künstler.
Die gemeinsame Grundlage von Flussers Argumentation zur Digitalität und McLuhans Gedanken zur Gutenberg-Galaxis bildet die Alphabetschrift und ihre Weiterentwicklung zum alphanumerischen Code. Für McLuhan brach damit die totale Dominanz des Auges an, die eine Vielzahl alternativer Erkenntnismöglichkeiten ausradierte, Flusser lässt sie schließlich im digitalen salto mortale hinunter in die empirische Bodenlosigkeit stürzen. Die beiden Stränge lassen sich aneinander knüpfen, sie beginnen dann gemeinsam zu resonieren, wenn Flusser in seinem Aufsatz zum ›Digitalen Schein‹ von einer potentiell allumfassenden Sinnlichkeit dieser neu entstehenden Welten zu sprechen beginnt (vgl. Flusser 2008:202) und damit teilweise Territorien von Marshall McLuhans topos des ›Africa within‹ (einer Art Rückkehr zu prä-literarischen, stammesähnlichen Gesellschaftsformen, deren Erfahrungsraum sich vorwiegend über Oralität organisiert) betritt. Beiden Konstruktionen wohnt eine sensorische Taktilität inne, die die Grenzen des Sehens hinter sich lässt, um sie zugunsten komplexer Erfahrungswelten aufzubrechen.
Die Indifferenz des Codes gegenüber seiner sinnlichen Form eröffnet uns nun nicht zuletzt die Möglichkeit, diese unwirkliche, geisterhafte ›Musik‹, die sich mal träge, mal fiebrig zitternd ihren eigenen Raum konstruiert, als temporäres Wirklichkeitskonstrukt zu denken und – mit Emphase – auch als solches wahrzunehmen. Ein auraler Erfahrungsraum mit allerhand verwirrenden, mystischen und teilweise beängstigenden Implikationen bezüglich unseres angestammten Status als Subjekt, der jedoch gleichzeitig das große Potential birgt, die Bürde desselben für einen Augenblick abzulegen, um frei durch den Klangkosmos zu flottieren.
Am Ende dieser realitätsblinden und fürchterlich technopositivistischen Mär angelangt, bleibt der Wermutstropfen der Kritik: der geschärfte Blick müsste sich demnach auf die Programmierer richten, um mithin nach den politischen Implikationen des Codes zu fragen.
Text
Robert Henschel
Fotografie
© Katharina Meinert
[togglegroup][toggle title=“Hör|Spiel“]
[/toggle][toggle title=“Quellen“]
FLUSSER, Vilém (2008 [1997]): »Digitaler Schein«. In: Ders., Medienkultur. Herausgegeben von Stefan Bollmann. 5. Auflage. Frankfurt/M: Fischer. S. 202-215.
HARTMANN, Frank (2003): »Instant awareness. Eine medientheoretische Exploration mit McLuhan«. In: Marcus S. Kleiner / Achim Szepanski, Soundcultures. Über elektronische und digitale Musik. Frankfurt/M: Suhrkamp. S. 34-51.
MCLUHAN, Marshall (1960): »Acoustic Space«. In: Edmund Carpenter / Marshall McLuhan, Explorations in Communication. Boston, MA: Beacon Press. S. 65-70.
[/toggle][/togglegroup]
[notification type=“success_alert“ title=““]Die Alben und Field Recordings von Lawrence English erscheinen auf Room40 (Link).[/notification]