[layout][layout_group][half_width]
So wie die Plastikfanfaren das wunderbare Album der reifen Popheroen Brian Eno und Karl Hyde einleiten, so bekennend und künstlich und dennoch wach und frei sollten wir uns in diese, meine Kolumne begeben, von der ich noch nicht weiß, wo sie so hinführen wird. Es gilt, hin und her zu mäandern, zu schauen, was passiert, wenn ich alle paar Wochen einfach einige sich positionierende Künstlerinnen und Künstler bzw. deren Releases aufzureihen versuche. Die diesmalige Auswahl und An-ordnung hat sich immer wieder neu arrangiert und ist nur ein illusionäres Festhalten und Einordnen, ein entspanntes Schleusenwarten mit Haltung und für Haltung, wie es das hiesige Magazin wünscht. Hey Mann und Frau, beurteilen und annehmen oder ablehnen tut es letztlich sowieso Ihr da drinnen. Darum auch ›So far … from now on‹. Bitteschön, hier sind ein paar Angebote, macht damit, was Ihr wollt, aber tut etwas!
Eno und Hyde tun etwas, sie erscheinen schon als Musikalisches irgendwie erwartbar, auch wenn Eno zumindest nach Roxy Music immer eher zurückhaltend und Hyde und sein Projekt Underworld durchaus intellektuell-proletisch wirkte. Zusammen haben sie neun Songtrack-Dinger gebaut, die mit den bereits erwähnten Synthie-Fanfaren auf ›The Satellites‹ beinahe einen hyperrealen und fast etwas nahe an Früh-Achtzigern befindlichen Traum-Trip vertonen. Also, der zu der Zeit spielt und also auch heute geträumt werden kann. Lange nicht mehr eine so heimelige Synthetik gefühlt. Dazu wiederum passt das Label Warp bestens, in seiner vielseitigen Geschichte. Es gibt viele kleine Über-raschungen innerhalb des Erwartbaren, und deswegen wird ›Someday World‹ hier so langsam zu einem Bestandteil schwerer Rotation. So etwa, wenn es in ›Daddy’s Car‹ so richtig funky und zwischendurch unpeinlich weltmusikalisch wird (Eno hat da ja reichhaltige Erfahr-ungen gesammelt) und dennoch Hydes Sprechgesang an ›Trainspotting‹ denken lässt. Eno und Hyde lassen durch das zunächst etwas unspektakulär anmutende ihrer Musik großartige Momente von Wohlgefühl und doch auch Kantigkeit erkennen, die durch Wiederholung eher leuchtender werden. Brian Ferry darf, ähem, mal wieder neidisch werden.
Mindest genauso interessiert an Musiktheorie, Perfektion-ismus, Soundtracks und Kontexten des eigenen Schaffens wie Herr Eno, ist bekanntlich auch Owen Pallett. Hört man Palletts neue Songs direkt im Anschluss an die Stücke von Eno und Hyde, so fügen diese sich in ihrer Struktur, im Rhythmus und vor allem Sound schon wunderbar an die der Alt- und Mittelalt-Meister. Pallett hätte bestimmt keine Probleme damit. Seine eigene Musik hatte immer schon einen Hang zu Vertonungen von Bildern, er hat Soundtracks und mannigfaltig Arrange-ments für andere Musikerinnen und Musiker produziert. Da allerdings, wo Eno, der hier übrigens mitwirkt, und Hyde mit ihren Songs schon ganz klar hinaus in die Welt gehen, scheint Pallett, bei allem ihm eigenen Pathos und Mini-Bombast, doch eher nach innen zu schauen. Auf seinen neuen Stücken beobachtet er die schönen Seiten von Wahnsinns-erfahrungen, also Erlebnissen des Kontrollverlusts, Irrationalen und auch Übersinnlichen. Kein Wunder, dass Palletts Songs dementsprechend stets leicht abgehoben oder verschoben, ja, ver-rückt klingen. Sie vertonen eine verrückte Reise ins Innere des Wahnsinns, um dort dann mit dieser seltsamen Fröhlichkeit der Depression(süber-windung) zu kokettieren und einen anzugrinsen, wie es u.a. nur die Beach Boys von ›Pet Sounds‹ oder der Epic Soundtracks von ›Rise Above‹ konnten. Wobei Pallett, und das ist toll, immer einen Schritt näher an der nächtlichen Tanzfläche zu sein scheint; bei gleichzeitig latentem orchestralen Glam.
Dean Warehams Tanzschritte auf seinen Konzerten oder denen seiner Ex-Bands Galaxie 500, Luna und zuletzt – und wohl auch noch aktuell – Dean & Britta wirkten von jeher eher zurück gezogen, der Introvertiertheit Palletts nicht unähnlich. Interessant, denn der gebürtige Neuseeländer mit Studienaufenthalt in Deutschland wirkt sowohl in seinem Look als auch erst Recht seiner Musik und seinen Bands eher absolut geschmackssicher. Bemerkenswert, dass solch stilsichere Typen dann auf der Bühne oder daneben auch gerne mal unfreundlich sind, anscheinend eher aus Unsicherheit denn aus Bösartigkeit. Wie dem auch sei, Wareham hat das Genre Dream Pop ganz entschieden mit beeinflusst, hat uns auf eingängige Art den Pop-Appeal der Velvet Underground nahe gebracht. Sein erstes (sic!) Solo-Album ist eine perfekte Melange aus allen anderen Projekten, freilich schon etwas deutlicher und mutiger als die vorhergehende, wenn auch schöne, so doch teilweise etwas unentschlossene E.P. ›Emancipated Hearts‹. Das gleichnamige Album hat Wareham wieder mit Britta Philips und Jim James (My Morning Jacket) aufgenommen. Hier ist die Fluffyness seiner früheren Bands ein ganzes Stückweit ausgeprägter, eine von Warehams großen Stärken, die ihn zum Helden jüngerer Acts dieses Genres macht: Tief melancholische Ausflüge mischen sich mit Kiwi Pop zu kleinen Hits für nachdenkliche Menschen. Bis zu den tollsten Momenten seiner bisherigen Bands ist noch etwas Luft, doch Songs wie ›The Dancer Disappears‹, ›Beat The Devil‹ oder ›Holding Patterns‹ lassen einen in ihrer traurigen Niedlichkeit weinen und dann auch besser fühlen. Ja, Katharsis mit Betonung auf der ersten Silbe. Wenn man Warehams neue Leichtigkeit akzeptiert, wird dieses Album immer größer.
Leicht sind die Stimmungen und Effekte der Inventions sicherlich nicht. Wobei hier leicht nicht gleichzusetzen mit schlecht und schwer nicht gut ist. Matthew Cooper von Eluvium und Mark T. Smith von Explosions In The Sky stehen auch mit ihren sonstigen Bands eher für schwere, langsame, dunkle Musik. Die bei Wareham ja eben besonders hervorzuhebende Mischung aus Easy Listening, Dream Pop, Indie Folk und manchmal sogar Chanson (kein Wunder, er ist Gainsbourg-Fan) weicht bei Inventions ganz klar der Langsamkeit und Düsternis eher psychedelischen Zuschnitts (wie ihn gleichwohl in manchen kurzen Momenten auch wieder Wareham walten lässt). Aus einem gemeinsamen Song auf dem letzten Album von Eluvium ist nun eine ganze Band mit Langspieler geworden. Und noch wichtiger: Das Zeug ist toll, nicht nur für Fans von Slow Core, Dream Pop, Ambient und Drone. Nein, Inventions ist immer ein kleines bisschen poppiger als die genannten Acts oder Genres. ›Echo Tropism‹ etwa könnte durchaus auch von Wareham geschrieben worden sein, wenn v.a. noch Gesang dazu käme. Wobei Inventions generell schon die Tendenz zum Ausufernden und auch mal Krachigen haben. Songs wie ›Flood Poems‹ oder ›Entity‹ docken genau hier an: Sie sind nicht falsch angewandter Postrock oder instrumentalistische Lange-weile, sondern eine ziemlich mitreißende eigene Welt in der tröstlichen Nachbarschaft zu Mono, Bersarin Quartett und Sigur Rós.
Einen klaren Schritt weiter in Richtung Trostlosigkeit gehen die australischen HTRK. Jonnine Standish und Nigel Yang verarbeiten offen hörbar den Tod ihres Bandmitglieds Sean Stewart. Waren die ersten beiden Alben dieses in Berlin lebenden Trios in ihrer Reduktion und kargen Wut ganz typisch für die Kombination Australien/Berlin (Iggy Pop, Nick Cave, Simon Bonney, Hugo Race etc.), so bewegen sich HTRK nunmehr anscheinend deutlicher in elektronische Gefilde. Wo sie zuvor eher eine sehr faszinierende Mischung aus Suicide und all den Australoberlinern (u.a. Birthday Party, True Spirit, Crime & The City Solution, These Immortal Souls, Once Upon A Time, The Fatal Shore) darstellten, kein Wunder, wurden sie doch vom verstorbenen Birthday Party-Gitarristen Rowland S. Howard protegiert und produziert (wofür sich Standish mit cool-stimmlicher Unterstützung für Howards leider erst posthum erschienenes, phantastisches letztes Album ›Pop Crimes‹ bedankte). HTRK hinken total hinterher, und das macht ihre Magie aus. ›9-5 Club‹ kommt, genau wie die drei Vorgänger ›Nostalgia‹, ›Marry Me Tonight‹ und ›Work (Work, Work)‹, ca. 20 Jahre zu spät und eben gerade nicht, HTRK arbeiten da vergangene Zeiten und Sounds auf. Nunmehr ragen Berliner Minimal Dub und andere reduktionistische Spuren noch deutlicher als auf dem bereits leicht opulenteren ›Work (Work, Work)‹ in die Reste vom HTRK’schen Anti-Rock’n’Roll hinein: ›The Body You Deserve‹. Mir gefällt diese Hoffnungslosigkeit, dumme Menschen nennen so was Depri-Mucke. »You’re driving me off the highway«. Yes, Baby, das tust Du. »You like my precious little sideways on my drive to perfection«. Na, dann mal los und weiter und stop. Schillernde Kühle. Übellaunigkeit kann so luzide sein. Wir reden hier von wirklich übler Laune wohl bemerkt, nicht vom Wutbürgerlichen. Letztere bereiten einem ja gerade ersteres.
[/half_width]
[half_width]
Diese Art der Stimmung auf die laut krachende Spitze getrieben hat stets Michael Gira. Wo Cave und die Bad Seeds oder Crime & The City Solution eher etwas selbstmitleidig, die Neubauten etwas oberlehrerhaft-künstlerisch und Throbbing Gristle schon wieder auch etwas zu nah am Museum waren, schienen Giras Swans im Studio und auch live die Kompromisslosesten. Um so erstaunlicher, dass das neue Album der Swans sehr an alle anderen genannten Bands und ihre Umfelder erinnert. Noch aufmerksamkeitsbindender erscheint, dass der Kolumnist genau diese Tatsache mag. Hm. Gira hat auf seinem eigenen Label viele Musikerinnen und Musiker unterstützt, u.a. die bezaubernde Lisa Germano. Gira hat den Industrial zugunsten eines brachialen Swamp Blues und Folks mutieren lassen, er geht nunmehr noch intensiver an die Wurzeln des Dunklen, Leidensvollen — auf drei LPs bzw. zwei CDs, Gira war noch nie für Kleinmütigkeit bekannt. Seid ihrer Reunion sind sie Schritt für Schritt besser und konzentrierter geworden. ›To Be Kind‹ ist der vorläufige Höhepunkt ihrer späten Phase, denn Wände, Wolken, unüberwindbare Konstellationen werden hier aufgetürmt und verklanglichen eine hermetische Macht: Die Swans werden nie Freunde des Zugänglichen sein. Sie bleiben, Song für Song, eine Herausforderung, und das meine ich nicht im blöden neoliberalistischen Rhetorik-Sinn (Problem = Heraus-forderung), sondern als echte Aufgabe, an der wir zu arbeiten haben, manchmal zehn, 17 oder gar 34 Minuten, um dann reichlich belohnt zu werden mit der Schönheit dieser Hässlichkeit. Danke, Michael und danke Daniel Miller von Mute Records, der nach Crime & The City Solution nun auch nochmals wieder die Swans begeistern und zwei seiner alten Lieblingsbands an Bord holen konnte: Ein Zentner schweres »I need love«, puh und wow gleichzeitig. Es scheint, ähnlich wie in den mittleren Achtzigern, wieder eine besondere Zeit für ausgedehnte apokalyptische Sounds zu sein; sich Zeit nehmen, um Entwürfe zu entwickeln, Auseinandersetzungen zu evozieren, nicht ewig auf Freundschaft aus, verdammt noch mal. Und somit immer auch ein Stückweit unsere Gesellschaften zu kommentieren.
Eher schwer als schwierig geht es weiter: Schwer wiegender Mut umschwärmt seit jeher auch die Projekte von David Eugen Edwards, ob mit 16 Horsepower, als Mitglied der reformierten Crime & The City Solution oder seiner zweiten und mittlerweile hauptsächlichen Band Wovenhand (früher in zwei Worten). Das ist schon der Preacher in bester Tradition vieler hier bereits genannter Crooner. Der Prediger hat das Pathos, das kann man dann mögen oder nicht, aber ohne dieses Pfund Aura funktioniert die ganze leidenschaftliche Zauberhaftigkeit eben nicht, das Ausschließen der spaßgesellschaftlichen Dauerverlachungen bedeutet gleichzeitig keinesfalls Selbstironielosigkeit. Blues ohne Gefühl scheint schwer vorstellbar. Wer diese Spielart nicht mag, sollte die beiden zuletzt und nunmehr genannten Alben besser nicht akustisch anfassen. Finger weg. Wo HRTK bewusst kühl und die Swans ebenso intendiert überblasen gewaltig sind, nehmen Edwards’ Songs an Geschwindigkeit auf, scheinen einen Horizont zu kennen, auf den man zulaufen kann (und den es für HTRK nicht gibt bzw. der von den Swans längst eingerissen wurde). Wovenhand besitzen offen hörbar Restelemente von Hoffnung, lassen insbesondere in den neuen Songs Lichtspitzen hinein in den Ozean des – immer wieder – Leidens und der ewigen Suche. Nicht eben periphere Themen, die uns alle angehen, selbst die, die meinen, angekommen zu sein (vgl. ›Push The Sky Away‹ von Nick Cave & The Bad Seeds). Edwards kennt den Blues, zieht sich stets aus, entkernt sich gleichzeitig und kleidet sich wieder ein in Fetzen aus Country, Wüstenrock, Folk, Punk, Psychedelic und Swamp. „Good Shepherd“ stampft sich klagend durch den tiefschlammigen Tanzboden. Wie der Song ›Corsicana Clip‹ belegt, kippt der schmale Lichtstrahl schließlich in eine krachende Darkness und ufert aus…
…und kommt wieder an bei dem dritten Teil des Jeffrey Lee Pierce Project, zu dem David Eugene Edwards ja eine Art Seelenverwandtschaft nachgesagt wird und dessen Songs hier nach den Folgen ›We Are Only Riders‹ aus 2010 und ›The Journey Is Long‹ aus 2012 erneut von zahlreichen Verehrerinnen und Verehrern weiterverarbeitet werden. Wobei hier nicht schlicht oder unschlicht gecovert wird, sondern wiederum ausgehend von Pierces altem Weggefährten Cypress Grove Demoaufnahmen, Skizzen, Notizen und Schnippsel des 1996 viel zu jung verstorbenen Kopfes von The Gun Club zur Aufarbeitung bereit gestellt wurden. Kaum eine Band hat so früh die Intensität von Blues und Folk mit der Wut des Punk und New Wave zusammen gebracht und durch die erkaltete, nächtliche Wüste gejagt. Insofern scheint ein von Iggy Pop, Nick Cave und Thurston Moore huldigend zusammen gespieltes Intro wie ›Nobody’s City‹ nur angebracht. Neben den treuen Mitgliedern des Projects wie eben Cave, Mark Lanegan, Debbie Harry, Lydia Lunch oder Gallon Drunks James Johnston (mit einem tollen, garagigen ›Body & Soul‹ feat. Jim Sclavunos und Cypress Grove) finden sich beim dritten Teil auch eher nicht so croonende Musiker wie Primal Scream, Andrew Weatherall oder Mark Stewart und weibliche Neo-Crooner wie Andrea Schroeder (ein federnd-gloomiges ›Kissses For My President‹, dass Pierce einst für Debbie Harry geschrieben hat und diese hier ebenfalls singt), Honey oder Black Moth. Wichtiger als all die Namen ist das Ausgraben dieser tollen Songs und Fragmente von Pierce, die durch die vorliegenden Interpretationen und Weiterführungen das Project tatsächlich zu einer eigenen, großen Band macht. Besonders hervorzuheben sind zudem die Tatsachen, dass in das Project auch immer wieder jüngere, noch unbekannte Bands einbezogen werden und dass Teile der Einnahmen einer gemeinnützigen Einrichtung zugute kommen, die in L.A. benachteiligten Kindern einen Zugang zur Musik bietet.
Die ersten Sekunden von ›Satellites‹ (hat nichts mit dem gleichnamigen Titel von Eno/Hyde zu tun, s.o.) könnten auch von Ben Frost oder Tim Hecker stammen, doch dann wird spätestens mit dem synthetischen Händeklatschen und Erika M. Andersons Gesang klar, dass hier das neue EMA-Album startet: Was gleichwohl nicht nur aufgrund seines klagenden Charakters hervorragend in diesen Kolumnenabschnitt passt, sondern tatsächlich in seiner majestätischen Apokalypsenhaftigkeit sowohl an die Swans als auch die eher aus der experimentellen elektronischen Musik kommenden beiden Herren Frost und Hecker erinnert. Frost hat auch Heckers letztem Album geholfen, Frost erscheint auf Mute, wo die Swans jetzt auch erscheinen, die ja eher aus dem Industrial kommen, und aus diesen Gefilden scheint auch EMA einiges an Kraft zu ziehen ebenso wie aus alternativen, wütenden Gitarrenmusiken. EMA läuft keinesfalls hinterher, das hat schon ihre umwerfende Cover-Version von Nirvanas ›Endless Nameless‹ (allein schon die Aus-wahl!) vor ein paar Jahren auf dem Tribute ›Newermind‹ des Magazins Spin belegt. Ja, EMA steht nicht etwa für die Adaption von deren ›Bleach‹ in seinem Metal- und auch nicht ›Nevermind‹ in seinem Ohrwurm-, sondern für ›In Utero‹ in seinem Noise-Grunge. Und bei einer zurückhaltend-schillernden Mini-Hymne wie ›3Jane‹ wird die (mediokre) Spreu vom (ergreifenden) Weizen getrennt und in den Haushalt der Trostsongs gebracht. Ist das schön. Ob nun Post Grunge, Beinahe-Dream Pop oder auch eine Portion New Wave und Industrial (›Neuromancer‹), EMA gräbt an den richtigen Stellen, sie trägt wichtige Erbbestandteile der guten Popmusik weiter, neu aufgebaut, versteht sich.
Wo EMA sich an den opulenteren Stilen weiter- und ab-verarbeitet, suchen sich die Herren von Kreisky eher frickelige Orientierungspunkte wie die Goldenen Zitronen, frühe Blumfeld oder auch SST-Bands der Achtziger vermengt mit einer ganzen Brise Post und Post Post Punk. Manchmal werden sie in ihrem verwinkelten Zorn mittlerweile etwas eingeholt von jungen Bands wie Messer oder Die Nerven. Aber Kreisky scheinen mir auch nicht wirklich den angry young man heraushängen lassen zu wollen. Dann schon eher den im Gegenüber zu Ja, Panik eher unschnöseligen, nicht ganz so dandyistischen Gentleman. Vergleiche sind ja so eine Sache, doch liegen mir Kreisky schon ähnlich nahe an den Goldies so wie Ja, Panik dies mit den späten Tocotronic tun, ja, subjektiv, momentan und stark gefühlt. Gleichzeitig wollen wir dier Rahmung nicht vergessen und docken die zornig-lakonischen Österreicher hier großartig am ›Here we are now, entertain us‹-Slacker- und Prokrastinations-Pussytum an (dem wir alle immer wieder fröhlich frönen), höre ›Wir Unterhaltenen‹, in deren furiosem Grande Finale Kreisky dann absolut an alle eben genannten Referenzen gleichermaßen erinnern. Wobei das Wir bald wichtiger als die Unterhaltenen sind. Denn wie Kreisky nimmt sich der Rezensent nicht aus, stellt sich nicht nach außen, nebenan oder gar oben, sondern mitten rein. Mitten drin im komplexen Leben voller Positionen sind eben auch Kreisky. Lärm, Leiern, Leiden, Lamentieren und dennoch nervig-aggressiv und abgrundtief zynisch sein können, das können so fast nur Kreisky. Endlose Pipelines, die Alpen und ein kleines bisschen Rätselhaft gibt es schließlich überall.
Kurzzeitig fand ich mich zu Beginn des Beginns dieser Kolumne in der Erklärungsbredouille, einen Rahmen, eine Klammer, wenigstens etwas Halt zu finden, in der Haltung der hier vorgestellten Musikerinnen und Musiker habe ich all das fast beiläufig gefunden, viele kleine Themen statt des einen großen Topos.
Wenn in dieser ersten Ausgabe meiner Kolumne übrigens tendenziell eher positiv kritisiert wird, dann ist das kein markt- oder medienkompatibles Kalkül, sondern das Zeug, was mir angenehm aufgefallen ist, was mich bewegt und in das sich nicht immer voll abgesichert eine Art roter Faden rein ziehen lässt. Der ganze Scheiß bekommt hier in der Regel sowieso keinen Platz, frei nach dem Motto »Gar keine Erwähnung ist die schlechteste Promotion!«.
[/half_width][/layout_group][/layout]
Text
Christoph Jacke
Fotografie
© Die Aufhebung
[togglegroup][toggle title=“Hör|Spiel“]
[/toggle][toggle title=“Schau|Spiel“]
[/toggle][toggle title=“Tonträger“]
Eno/Hyde, »Someday World«, Warp Records, 2014
Owen Pallett, »In Conflict«, Domino Records, 2014
Dean Wareham, »Dean Wareham«, Sonic Cathedral, 2014
Inventions, »Inventions«, Temporary Residence, 2014
HTRK, »9-5 Club«, Ghostly International, 2014
Swans, »To Be Kind«, Mute, 2014
Wovenhand, »Refractury Obdurate«, Glitterhouse Records, 2014
V/A, »Axels And Sockets«, Glitterhouse Records, 2014
EMA, »The Future’s Void«, City Slang, 2014
Kreisky, »Blick Auf Die Alpen«, Buback Tonträger, 2014
[/toggle][/togglegroup]
[notification type=“success_alert“ title=““]Christoph Jacke ist Professor für ›Populäre Musik und Medien‹ und hegt einen Faible für die abgründigen Seiten des Pop.[/notification]
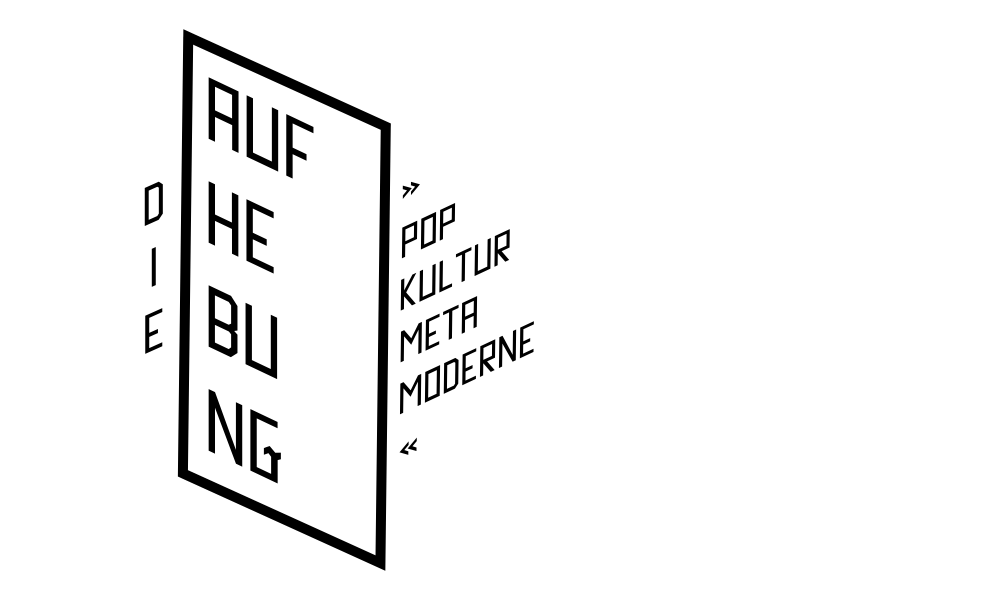


One Comment