[layout][layout_group][half_width]
„Die akademische Forschung ist nur in Reservaten zu finden, wobei es da keine Kritik im engeren Sinne gibt, sondern eine Mischung aus der Beschäftigung mit ‚Pop’ als Großgegenstand und der didaktischen Anleitung zukünftiger Popmusiker. Von der Relevanzfrage keine Spur.“ (Terkessidis 2015b: 36) Ja, es hat sich was angehäuft. Wobei das doch sehr nach toten Fruchtfliegen in der Apfelsaftschorlenfalle neben dem Herd oder aktuell etwas schwer vorstellbaren Geldstapeln à la Dagobert Duck anhört. Nein, es ist Musik, zu der ich Stellung beziehen möchte und – sowohl journalistisch als auch akademisch, hier in bewusster Mischform – dem geschätzten Kollegen Mark Terkessidis etwas entgegnen und dessen sicherlich nicht ganz zu Unrecht gesetzte Provokation aufnehmen möchte. Wobei ich seine Setzung als anregend annehmen, die offenbar verkürzte Recherche eher als etwas oberflächlich abwehren möchte. Mein Motto für die Auswahl der vorliegenden Alben ähnelt da eher schon dem der Musikjournalistin Jessica Hopper: „I have a strange relationship with music. It is strange by virtue of what I need from it. Some days, it’s the simple things: distraction, entertainment, the sticky joy garnered only from Timberland beats. Then, sometimes, usually early in the part of the morning that is still night time, most especially lately, I am painfully aware of every single thing that I need from music, embarrassed by what I ask of it. Having developed such a desperate belief in the power of music to salve and heal me, I ask big, over and over again. I have an appetite for deliverance, and am not really interested in trying to figure out whether it qualifies me as lucky or pathetic.“ (Hopper 2015: 11) Mit dieser Kolumne, die sich als alles andere denn als Produktinformation versteht, möchte ich auch einer Kritik des Kunstjournalisten Jörg Heiser gegenüber treten: „In der Popmusikkritik gibt es übrigens ähnliche Tendenzen: wir erfahren oft alles über die Eigenheiten der Mitglieder einer Band, über Texte oder Genre-Einordnungen, und nichts über die eigene Hörerfahrung.“ (Heiser 2013: 147) Ich denke, gerade das Einordnen und Bewerten nach nicht immer objektiven Maßstäben, also nennen wir es subjektabhängig, aber nicht subjektiv, sollte hier eine dezidierte Rolle spielen. Dabei kann sich durchaus des von Heiser vorgeschlagenen Kriterienkatalogs angenommen werden: „Es lassen sich aber vielleicht doch fünf Grundfragen formulieren, die als Leitgedanken Geltung behalten: Erstens, reflektiert das Kunstwerk seine Zeit? Zweitens, setzt der Künstler/die Künstlerin das Material auf gekonnte, intelligente oder/und fantasievolle Weise ein? Drittens, ist das resultierende Kunstwerk benennbar originell, witzig oder geistreich? Viertens, berührt mich dieses Kunstwerk oder überrascht es mich, erfahre ich neues (zumindest eines davon)? Fünftens, wenn ich das Kunstwerk an den in ihm enthaltenen oder es flankierenden Behauptungen messe, hält es dann diesem Vergleich stand, löst es seine ‚Versprechen’ wirklich ein?“ (Heiser 2013: 150) Auf die ebenfalls von Heiser sehr zu Recht erwähnte Verwobenheit in die hier nunmehr v.a. musikindustriellen Kontexte kann hingegen mit zumindest teilweiser Unabhängigkeit im Verweis auf das eigene Tun verzichtet werden: „So oder so ist der Kritiker der Gegenwart ein Netzwerker, ein Selbstnetzwerker und in diesem Sinne eigentlich kein Kritiker mehr , denn auf Distanz gehen zu etwas ist nicht vorgesehen: Sie oder er muss ständig darauf bedacht sein, aus dem selbst mit gewobenen sozialen Netz nicht herauszufallen. Diese Welt digitaler Vernetzung, die Kritik in der Regel nur als Link kennt oder als schweigendes Ignorieren (Freundschaftsanfrage für immer unbeantwortet lassen etc.), korrespondiert dabei mit einer sozial prekären Situation im freien kulturellen Schaffen, in der offene Konfrontation als existenz-bedrohend empfunden wird.“ (Heiser 2013: 150) Deswegen ist es m.E. gerade in popkulturellen Bereichen und ganz im Anschluss an Terkessidis sinnvoll, nicht nur zu beobachten, sondern auch zu intervenieren. Sicherlich bleibt diese, wenn auch nur partielle eigene Verwobenheit in die künstlerischen Kreise und noch deutlicher in die industriellen Kreise eine ständige Herausforderung: „Die Kunsttexte sind ‚hybride’ Texte, die zwischen Theorie, Kommentar und Kritik schwanken. Dabei machen sie auch die ambivalente Rolle ihrer Autoren deutlich, die zwischen Gesellschaftstheoretiker, Kunstrezipient und Kunstkritiker schwanken.“ (Danko 2013: 155) Also warum eigentlich nicht auch mal schwanken? Wackeln? Den Boden verliere ich deswegen nicht unter den musikbegeisterten Füßen. Und wie bereits in den voran gegangenen Teilen der Kolumne erwähnt, ergibt sich durch die von Hopper genannte Beziehung zur Musik hier quasi-automatisch das Bedürfnis, die begeisterungsfähigen Alben herauszufiltern, statt auf all den Mist zu blicken und ihn anzuhören (vgl. zu meinem wissenschaftlichen Verständnis von Popmusikjournalismus auch Jacke 2005, 2014, die Beiträge in Jacke/James/Montano 2014 sowie Jacke/Kavka 2015). Wobei zudem gute negative Kritiken sehr viel aufwendiger erscheinen. Vielleicht sollte ich demnächst einmal eine ganze Kolumne nur mit Verrissen schreiben. Es gibt da draußen und hier drinnen so viel Scheiß. Gleichwohl wäre dann Raum und Aufmerksamkeit für die vielen wunderbaren Musiken genommen; das Malheur des ‚unendlichen’ Cyberspace. Meine Haltung jedenfalls und somit auch die Konstruktion von Relevanz innerhalb meines Filterns befindet sich wiederum ganz in der Nähe des entworfenen Modells für Kunstkritiker bei Heiser: „Den Scharfrichtern spricht man Kritikfähigkeit zu, den Schwärmern Einfühlungsvermögen. Empathie ohne Kritik aber ist kopflos; Kritik ohne Empathie ist blind. Ich möchte eine Kunstkritik skizzieren, die aus dieser falschen Wahl zwischen Nähe und Distanz ausschert und sozusagen stereoskopisch schaut und damit plastisch. Sie mag ein Ideal sein, aber in Ansätzen, gelungenen Momenten existiert sie. […] Ich schlage zwei Rollenmodelle dafür vor. Die radikalkritischen Fans: aus der Nähe entwickeln sie Distanz. Und die glühend Distanzierten: aus der Distanz entwickeln sie Nähe.“ (Heiser 2013: 148).
Und jetzt…
Im Grunde höre ich die ganze Zeit Musik, begleiten mich die vielen hier erwähnten Alben durch die letzten Monate und Wochen. Neben anderen, die woanders oder auch mal gar nicht besprochen werden. Als sowohl radikalkritischer Fan als auch glühender Distanzierter bewegen sich diese Sounds in meinen Alltag und aus ihm heraus (vgl. zu Aspekten der Transzendenz und Quasi-Religiosität statt anderer Dworkin 2014, Hörisch 2013, Taylor 2013 sowie auch die hiesige Kolumne #02). So sollen sie auch in dieser Kolumne behandelt werden, Aufmerksamkeit erhalten, gleichwohl eingewoben werden in einen hier (re-)konstruierten Flow zwischen Emotionen, Reflexionen, Technik und Sounds, durchaus nicht immer nur erhellend, mal geht es eben gefühlt voran, mal zurück (vgl. zu Progression und Rezession in der Popmusik auch sehr lesenswert und diskutabel Winkler/Bergermann 2003 sowie grundlegend Jacke 2004). So erging es mir vor einiger Zeit an zwei denkbar unterschiedlichen Orten mit sehr verschiedenen Live-Konzerten: In der Volksbühne in Ostberlin reiste ich beim brachialen Konzert der Swans irgendwie zurück in ein zwar als Kind und Jugendlicher erlebtes, aber doch wohl eher imaginiertes und aktuell viel diskutiertes Westberlin der Achtziger, gleichzeitig waren die Swans für mich sehr präsent und wirkten, trotz (oder wegen) ihres Alters weder nostalgisch noch hauntologisch (vgl. Fisher 2015), sondern fast menschmaschinenartig voran stampfend und gleichzeitig schwitzend, empfindend, getragen von einem radikalkritischem Publikum in der mit Geschichten behafteten, außeralltäglichen Volksbühne. Nach dem Konzert begann es vor dem Theater zu gewittern. Anders dann oder eigentlich davor Die Nerven auf dem „AStA“-Sommerfestival der Uni Paderborn. Vor an ihrer Seitenbühne kleinerem Publikum, sommerlich noch im Hellen, auf einer der größten universitären Partys in Deutschland spielten Max Rieger und Band ein kurzes pointiertes Set, welches mich aus dem Alltag des Campus, der bis mittags griff, hinaus hievte. Nach der Show verabschiedete ich unseren wundervollen Gastdozenten und erfahrenen Musiker Mike Jones aus Liverpool, mit dem ich zuvor noch über Post Punk, New Wave, Industrial und die ganzen Pop-Szenen in Mikes Wohnort Sheffield diskutiert hatte und der mir gestand, dass er kein Wort von Die Nerven verstanden hatte, aber wusste, was diese meinten und dass sie Haltung, oder vielleicht besser Anti-Haltung-Haltung hatten. Beide Bands und ihre Auftritte brachten etwas in Unordnung und zeigten gleichzeitig Wege auf: „Die Utopie ist eine performative Waffe, sie stellt in Frage, schafft Unordnung.“ (Bunz 2004: 157) Nun, das neue Album von Die Nerven erscheint in ein paar Wochen, das letzte der Swans ist schon länger veröffentlicht und wurde bereits in Kolumne #01 behandelt. So far…from now on: Vielleicht sehe bzw. höre ich, wie Mike, in allen hier touchierten neuen Alben ein kleines utopisches Moment oder auch mehr, vielleicht ist das sogar die Terkessidis’sche Relevanz, die oben angesprochen wurde.
Nun aber…
Relevanz und Haltung verkörperte für mich der Brite Jeremy Warmsley vor einigen Jahren, als er neu und voller Energie auf dem Indie-Pop-Markt auftauchte und so ganz nebenbei die schönste Coverversion des wunderbaren New Order-Klassikers Temptation produzierte. Nun, das war vor Jahren, das neueste New Order-Album auf Daniel Millers Mute-Label erscheint auch gerade, dazu gleich mehr. Währenddessen hat Warmsley mit seinem für mich bisher etwas lauen Projekt Summer Camp mit Elizabeth Sankey plötzlich diese Aufgeregtheit seiner frühen Solojahre wiedergefunden. Summer Camp freilich bleiben sonniger, fast zu heiter und kunterbunter als Warmsley alleine. Doch Bad Love scheint einen guten Einfluss zu haben. Denn waren sie bisher so etwas wie die naiven, sehr jugendzimmerlichen Kinder von Pulp, so sind sie endlich zumindest in der Adoleszenz angekommen und alles wird erfreulich differenzierter. Klar, Hits sind das alles, aber eine leichte Melancholie in all der Aufbruchsstimmung zeichnet sich doch etwa sogar in Songs wie Feel Right ab. Gleich aber nochmal Temptation als Warmsley- und in der originalen 12“-Version raussuchen. Zurück also zu New Order, deren Oberflächen mal wieder ästhetisch überaus ansprechend ist: Das Graphikdesign des neuen Album Music Complete wurde erneut vom Factory-Hauskünstler Peter Saville gestaltet und erinnert in der Tat sehr an Mondrian. New Order ohne Peter Hook sind eigentlich kaum vorstellbar aufgrund dessen unglaublichen Wummer-Basses, der bis heute in seinem Sound immer wieder nachgespielt wurde. Dennoch kehren sie zu ihrer mehr an innovativer Dance Music orientierten Stilistik zurück, verlassen das teilweise etwas rockistische Gebahren der letzten Alben. Wobei gerade Hook selbst gerne z.B. live immer den breitbeinigen Rockstar hat raushängen lassen. Für mich stand das immer im Widerspruch zu Sound, Text und auch eben auch Design der Band. Wieso Fotos mit coolem Gestus und Sonnenbrillen, wenn das Image der Band offenbar sehr stark in einer antirockistischen, reflektierten Post Punk-Strömung zu verorten war? Music Complete reiht sich wieder mehr dort ein, ohne gleich auf die Schuhe glotzen zu müssen. Das tut den Manchester Heads gut, denn genau diese Mischung aus Indie, Post Punk, New Wave und Disco, House, HipHop machte die Band etwa auf den wegweisenden Alben Power, Corruption and Lies (1983) oder Low Life (1985) so spannend. Die erste Single aus Music Complete, Restless, steht erfreulich symptomatisch für diesen bescheiden-souveränen, einmaligen Stil der Band, da haben sich Sumner, Morris und Co. gefunden, auch ohne Hooky. Das wird dann schon mal etwas großspurig wie auf dem offenhörbar vom Chemical Brother Tom Rowlands produzierten Singularity, doch gehörte dieses Spiel mit Pathos, Bombast und Emotion im Indie-Kleid immer zu den Vorzügen von New Order. Mir gefallen die kleinen Hymnen wie eben Restless oder Academic besser als die pompöseren Opern wie z.B. Plastic oder das beinahe an Trevor Horn-Produktionen à la Frankie Goes To Hollywood erinnernde Tutti Frutti. Wobei Sumners Gesang den roten Faden bildet und auch der Song seinen typischen New Order-Weg spätestens mit dem Refrain dann wieder findet.
Nimmt man Tempo, Bubblegumhaftigkeit und Brit Pop aus Summer Camp und Danceability aus New Order heraus, landet man bei den wesentlich entschleunigteren Japanern von The Silence, die nach der Auflösung von Ghost dem Shoegazing-Kraut huldigen. Schräger und indie-bombastischer als Summer Camp starten The Silence gleich mal mit der Hymne Lemon Iro No Cannabis. Bläser und Orgel weisen den Weg. Flöten schließen sich an. Dennoch ist das nicht überlastet oder gar -blasen. Summer Camps Album steigert sich, während The Silence einen sofort gefangen nehmen und das Hymnenhafte dann balladesk, ja fast hippiesk (Götter im Exil, der Song heißt wirklich so und lässt die Zuneigung zu deutschem Kraut à la Can anklingen), später beinahe garagig werden lassen. Das erinnert sehr an sanfte Psychedelik vor allem aus den USA der Neunziger.
Dass man nicht nur erinnern, sondern auch vergessen und verschüttete, von vielen nicht mal vergessene, sondern (noch) gar nicht erst entdeckte tolle Songs versammeln kann, hat unser Lieblings-Fraktus, Ex-Dorfpunk und Schlager-in-Anführungszeichen-Mann Rocko Schamoni auf seinem nun wirklich bemerkenswerten neuen Album Die Vergessenen gezeigt. Wo der schon erwähnte Mark Fisher bei dem Fatalen des Verlernens des Vergessens im Zeitalter der Totalspeicherung spricht, hievt uns Schamoni schnell nochmal einige großartige deutsche im Sinne von deutschsprachige Popsongs – ähem – unvergessenener und teilweise so oder in anderer Formation noch existierender Bands wie von den Lassie Singers, Mutter, GUZ, der Freiwilligen Selbstkontrolle (F.S.K. und deren legendäres Was kostet die Welt) oder Die Regierung ans popmusikalische Tageslicht. Wie auch immer, ob neu, anders, wieder: Ein Song wie das herzerweichende Loswerden der Regierung, zwischenzeitlich auch schon mal wundervoll gecovert von den Walkabouts (noch zu hören auf der Glitterhouse-Label-Compilation Out of the Blue Vol. 2), nun hier, wie alle Versionen, orchestral und irgendwie ganz unironisch, dennoch voller Witz, aufbereitet, berührt. Schamoni, der in einer Folge der TV-Talkshow Zimmer frei bereits überraschend nahe Einblicke in sein Seelenleben gab, ohne sich wutbürgerlich (schade, dass dieses Wort mittlerweile so negativ belastet ist, so meine ich es hier auch, irgendwann hieß das ja mal engagiert, nunmehr krakeelend) zu offenbaren. Das hier ist nicht Weglauf- oder Verdräng-Ironie, sondern fein distanzierte Nähe in orchestralem, manchmal beinahe (durchaus uneasy) Easy Listening Popgewand namens Mirage. Ja, vielleicht ist auch Rocko ein auf seine Art radikalkritischer Fan. Ich hätte einige dieser Songs auch ausgewählt, ganz undilettantisch und entgegen des Vorwurfs des Museumsdirektors Stephan Berg gegenüber der (bildenden) Kunst, dass diese sich vornehmlich über Marktwert definiere (vgl. Berg 2015, vgl. zur über-quantifizierten Welt auch Raunig 2012, Crouch 2015). Danke, Rocko! Auch die Songs der beiden jungen Frauen von Schnipo Schranke könnten ihren Weg auf einen imaginierten zweiten Teil der „Vergessenen“ passen, wobei auch Schnipo Schrankes Mini-Hits wie Pisse zumindest einer Menge Insidern bekannt sein werden, denn, wie eigentlich alle Acts auf Schamonis Album, werden die chansonesk-dilettantischen’ Liebes-Stücke von Schnipo Schrankes Debüt Satt mit Sicherheit ihre Runde machen, dafür sind sie für, sagen wir, für Indie-Kreise einfach mehr als gut und kompatibel genug. Es wirkt, als würden Friederike Ernst und Daniela Reis stets kämpfen, gegen psychische Windmühlen, eigene Geschichten, gesellschaftliche Verhältnisse und den ganzen Zwang, und das schon (oder gerade) mit Mitte zwanzig. Entscheidend bleibt der Humor, die Selbstironie, wie sie für diese Bands und auch die Zuhörenden zum Weitermachen wichtig ist. Ebenso gilt das für die Gottväter des gebrochenen Weitermachens, Die Goldenen Zitronen, die es mit ihrem ersten englischsprachigen Album tatsächlich schaffen, offensichtlich wie eines ihrer großen Vorbilder zu klingen, Mark Stewarts Pop Group. Schorsch Kamerun leiert-eiert ganz nah an Stewart heran, der sicherlich nicht zufällig auf dem vorletzten deutschsprachigen Album auch Gastsänger war (Drop The Stylist), das hier, fast etwas schade, nicht nochmals stattfindet. Auf Flogging A Dead Frog versammeln diese Instrumentals und eingeenglischte Stücke ihrer letzten Alben, die mit If I Were A Sneaker das schon vor Jahren auf Lenin als Wenn ich ein Turnschuh wär sehr angebrachte und gegenüber europäischem Verhalten zu den Hilfe suchenden Flüchtlingsströmen zu Recht sehr kritische Kommentare abgab. Oder mit The Investor oder Businesspeople 2.1, im Original Der Investor und Kaufleute 2.0.1 von Who’s Bad die Stadt- und aktuellen Wohnpolitiken attackieren. Es funktioniert. Das zeigt die Größe dieser Band, auch wenn sie so was wahrscheinlich gar nicht gerne hören. Die Haken, die die Goldies schlagen, bleiben immens irritierend-wichtig, vielleicht ja jetzt sogar nochmal mehr auch für ein internationales Publikum. Für alle diese deutschen Bands gilt, dass sie über eine bestimmte Art von Witz und aber niemals Dauerironie-Trash, eine Art von Kommentar zur Zeit abgeben. Ich muss dabei an Diedrich Diederichsens Überlegungen zum Genie und seinen Geräuschen in seinem Katalog-Text zur Münchner Ausstellung „Geniale Dilletanten. Subkultur der 1980er- Jahre in Deutschland“, die sich an die bewusst falsch geschriebene Aktion und den dazugehörigen Band Geniale Dilletanten von Wolfgang Müller mit u.a. Blixa Bargeld, Gudrun Gut und Alexander v. Borsig anlehnt (vgl. Müller 1982), denken (vgl. Diederichsen 2015), auch wenn es bei Schamoni, Schnipo Schranke und selbst den Goldenen Zitronen nun offenhörbar weniger um akustische Experimente zu gehen scheint. Ähnliches testeten vor über zwanzig Jahren die amerikanischen Dinosaur Jr. aus, die neben den Screaming Tress so etwas wie die zuckersüß-krachige Ausgabe von Grunge waren. Neben J. Mascis von ersteren hat sich schon früh auch Lou Barlow von seiner eigenen Indie-Supergruppe Dinosaur Jr. emanzipiert und u.a. mit seinem damals neuen Projekt Sebadoh (und später der Folk Implosion) oder auch als Sentridoh (im Grunde solo) wieder fast den Weg zurück zu Homerecording und Anti Folk (nur hieß das seinerzeit noch nicht so) gefunden. Sein unter eigenem Namen erschienenes Soloalbum Brace The Wave ist nackt und intensiv. Die neuen Songs hatten sich schon länger angesammelt und wurden in nur sechs Tagen (!) mit dem auch für die drei Comeback-Alben von Dinosaur Jr. verantwortlichen Ingenieur Justin Pizzoferrato aufgenommen. Barlow selbst beschreibt den Aufnahmeprozess als außerordentlich engagiert, Songs wurden teilweise erst im Studio geschrieben bzw. in ihrer Performance entwickelt. Und das hört man, indem hier ein Sound des Dabeiseins entstanden ist und einen quasi direkt neben Barlow sitzen und seine runter gestimmte Ukulele spielen hören lässt. Spätestens bei Nerve erblüht die Gänsehaut. Intimität entsteht ebenso bei den sehr melancholischen Songs von Bill Fay, der auf einem erdachten Festival sehr gut gemeinsam mit Barlow auftreten könnte. Who Is The Sender? fragt man sich sofort bei Fay, der einem bisher so wenig über den Weg gelaufen ist bzw. von den Musikmedien angeboten wurde. Nach Nerve von Barlow bitte The Geese Are Flying Westward anhören und kathartisch weinen. In bestimmten, folkigen, klavierlastigen oder auch orchestralen Momenten fühle ich mich an die besten Momente der irischen Waterboys erinnert. Das entscheidende Wort hier ist „fühlen“. Fay selbst beschreibt seine Songs als Alternative Gospel. Ray Davies von den Kinks hat sein Studio zur Verfügung gestellt, um Fay nun bei dessen zweitem Comeback-Album nach Life Is People (2012) zu unterstützen. Der Mann hat Anfang der Siebziger seine ersten Alben aufgenommen, wurde zwischenzeitlich vergessen, dann immer mal wieder von Musikern wie Nick Cave, Jim O’Rourke oder Wilco erwähnt oder gecovert. Man hört auf Who Is The Sender?, warum.
Erinnern
Covern ist eine besondere Art des Nicht-Vergessens (für Outsider) oder auch einmal nur des Erinnerns (für die schon erwähnten Insider). Und um nicht missverstanden zu werden, es geht hier und jetzt um brandaktuelle Veröffentlichungen, nicht um pure Nostalgie (darf niemals siegen). So auch bei den folgenden beiden Alben mit Coverversionen im aktuellen Kleid. Auch diese haben eine Relevanz, ohne die Originale kennen zu müssen, können aber auch zum Diggen veranlassen, und das kann bei zunehmender Popmusikgeschichte Spaß machen. Diese Doppelsinnhaftigkeit verführt. Yo La Tengo haben mit ihrem ersten Versuch, Fakebook, 1990 bereits eines ihrer eindrucksvollsten Alben vorgelegt. Nun, 2015, schließen sie daran an und covern sich selbst und diverse Hits und Nicht-Hits eben dieser, unserer Popmusikgeschichte. ‚Zeugs wie dieses da’ schenkt uns eben neben neuen Varianten eigener Songs und zwei gänzlich neuen Songs (Rickety, Awhileaway) Interpretationen von Hank Williams, The Lovin’ Spoonful auch das mitreißende Friday I’m In Love von The Cure, das so schön bisher nur von Dean & Britta (Ex-Galaxie 500, Ex-und-wieder-Luna) eingespielt wurde. Und diese beiden wiederum finden sich mit ihrer erneut luziden Version von hier jetzt Donna Reginas Driving In Your Car auf dem Album Dis Cover – Donna Regina As Recorded By neben u.a. Schlammpeitziger, Console, Mouse On Mars, Dani Siciliano oder Thomas Fehlmann feat. Gudrun Gut. Das Electronica-Duo Regina und Günther Janssen hat es über einen gewissen Status leider nicht hinaus geschafft, dafür waren auch ihre Songs wohl zu intim und auch eckig, bei aller Melodiösität. Dass sie hier von so unterschiedlichen Musikerinnen und Musikern bearbeitet werden und in den neuen Versionen erst Recht fast zeitlos klingen, freilich zeigt ihre Bedeutung für bestimmte Kreise, weit über Köln und Berlin hinaus.
Jetzt wieder nach vorn
Obwohl wir ja gar nicht nur zurück geschaut haben, jetzt mal wirklich komplett nach vorne mit einigen Damen, die sich (OK, ein bisschen Tradition darf sein) absolut rockend in den verschwitzten, oftmals in der Haltung (nicht immer im Text und eher nicht im Sound) ironisch gebrochen männlichen Swamp Blues einreihen. Wer mit einem bollernden Bass, noisig-bluesiger E-Gitarre und an Steve Albinis Drumsound erinnernd mit dem Song Black Flag beginnt, darf sich nicht wundern, in Referenzen, wahrlich allerbeste, gesetzt zu werden. Ja, nennen wir Momente der Jesus Lizard und – hier nun wirklich adäquat und als Kompliment gemeint – Polly Harveys Energie. Beth Jean Houghton wird damit gut leben können, ihr Alter Ego Du Blonde klingt hart, dreckig, dennoch fast mathematisch präzise. Jim Sclanvunos, der die letzten Jahre Nick Caves Bad Seeds und vor allem Grinderman mitgeprägt hat und früher bereits mit Sonic Youth, Lydia Lunch und The Cramps gespielt hat, produzierte Welcome Back To Milk. Du Blonde aka Houghton selbst hat hier zweifellos aber alles fest in ihrer Hand, blickt nach eigener Auskunft auf ihr bisheriges Leben zurück, wird auch mal ruhiger, regt sich aber alles in allem schon mächtig und kraftvoll auf. In die genannten Kontexte fügt sich auch Shilpa Ray nahtlos ein, die ihre Kraft deutlicher in das Dunkel umleitet, wo Du Blonde eher ausbricht. Shilpa Ray ist u.a. mit Patti Smith, Elvis Costello und A Place To Bury Strangers aufgetreten, besonderen Support im wahrsten Sinn des Wortes (als Vorband und auch Background-Sängerin) hat die Brooklynerin von eben jenem schon genannten Cave und dessen Bad Seeds erhalten. Ich hörte zufällig und ganz nebenbei neulich in der Küche über ByteFM Rays Hymn (oder war es Pop Song For Euthanasia?) und musste sehr zeitnah recherchieren, um an mehr von dem Zeug zu kommen. Ein tolles Finale des Albums, aber die Songs davor sind genauso mitreißend. Dass sich Ray dabei auch nicht gleich wieder zu ernst nimmt, was bei zuviel Pathos bekanntlich drohen kann, zeigt etwa das offizielle Video zu Nocturnal Emissions. Mir gefällt das deutlich besser als Anna von Hausswolff oder Anna Calvi; Shilpa Ray scheint deutlich näher an der stilsicheren Gosse und Garage gelagert, sie meckert oder klagt eher genervt als das sie croont. Das wiederum kann Richard Hawley absolut glamourös. Auch auf seinem neuen Album Hollow Meadows tut er das, sogar noch gebrochener, rauer als zuvor. Der vor 15 Jahren von seinem alten Buddy Jarvis Cocker zu seiner Solokarriere überzeugte Hawley provoziert wie kaum ein anderer Vorstellungen von verregneten Großstdadtstraßen bei Nacht, hochgeschlagene Trenchcoatkrägen und schillerndes Verlassen(-Werden). Von I Still Want You bis What Love Means gelingt Hawley mal wieder ein einzigartiger Sound des Versöhnens in all der Trauer. Für mich bleibt Hawley ganz klar der Sinatra der Swamp Blues Crooner. Zwischen Hawley, Du Blonde und Shilpa Ray hätte The Cairo Gang einen recht guten Platz: Grandezza spielt auch in Emmett Kellys Songwriting eine Rolle. Schon An Angel, A Wizard wirkt wie eine gelungene Kreuzung aus Hawley und Calvin Johnson. Die Cairo Gang schüttelt funkelnde Popsongs aus dem Ärmel, scheint eine Garagen- oder Indie-Ausgabe der Byrds oder auch der Revolver-Beatles zu sein. Da wird auch vor einer Drum Machine auf Sniper nicht zurückgeschreckt, die, noch positiv erschreckender, dieses Stück zum Ohrwurm mitmacht. „I feel like I am fading this time…“, was für ein an einem hängen bleibender Song, oder um es mit dem Infosheet zu sagen: „Keep on dancing.“ Tanzen, Herumspringen, ja, Pogen kann man, frau, sonst wer nahezu mathematisch zu den pointierten Noise Rockern von Metz. Nunmehr auf dem zweiten Album II. Wie schon beim Debüt vor drei Jahren brauchen Metz nicht viel Zeit und Raum. Die Kanadier sind nun wirklich konzentriert. Mehr Helmet, Tar oder Shellac denn Jesus Lizard oder Scratch Acid und doch klingen bei aller Gründlichkeit und Komprimiertheit leichte psychopathische Ausbruchsmomente kräftig durch, höre Acetate. Mensch, das wird ja ein richtig netter Kaffeetrinksonntagnachmittag. Mit Metz im Ohr. Wieso können über 40-jährige nicht auch mal abdriften? Ach so, geht ja. Spring. Metz werfen einen zunächst aus der Spur, um einen dann auch gleich wieder mit Gitarre, Bass, Schlagzeug, Gitarre und Schreigesang (in dieser Reihenfolge) rein zu schubsen. Mit genau dem richtigen Timing. Schneidend. Klirrend. Niemals antiseptisch. Wo wir schon bei Helmet (vor allem bei deren John Stanier) und Mathematik sind: Die Battles sind nicht ganz so belanglos, wie es der Titel ihres dritten Albums vermuten lässt, zurück. Nachdem Gloss Drop in 2011 ihr Bombastalbum inklusive Gaststimmen von u.a. Gary Numan war, geht La Di Da Di wieder deutlich zum Instrumentalen, etwas mehr Reduziertem zurück. Was bei Stanier, Williams und Konopka keineswegs Minimales bedeutet. Nochmal der Verweis auf den Titel (und in Songtiteln wie Summer Simmer, Luu Le, The Yabba, aber auch Flora Fauna, Dot Net und Dot Com taucht das auch auf): Die Essenz aus einem Kinderlied ist ja gerade eine Art Wiederholung, Säuseligkeit, weil Einprägsamkeit. Battles grooven mit ihren neuen Stücken zwischen Natur und ‚neuen’ Medientechnologien hin und her, lassen sich nicht festlegen und finden dennoch ganz souverän ihren sexy-frickeligen Weg, Ansexeltipps Dot Net und Cacio E Pepe. Ought sind mir mit ihrem Debüt More Than Any Other Day seltsam halb aufgefallen, das Album ließ mich nie richtig los, und als ich es unbedingt nochmal in Ruhe hören wollte, stellte ich fest, dass ich es weggegeben hatte. Allerdings nur physisch, auf dem Rechner ist es noch, lang lebe die Digitalität. Nun rauscht Sun Coming Down heran und erhält von mir quasi doppelte Aufmerksamkeit, um die eigene Schludrigkeit wieder gut zu machen. Viel besser: Das ist gar nicht nötig, denn im Sinne des oben genannten Gebrauchs und Brauchens vom Musik laut Jessica Hopper bauen sich hier diverse Beziehungen auf, ob strange oder nicht. Ought aus Montreal zappeln sich durch das Indierock-Kontinuum und ziehen dieses nunmehr durch Raum und Zeit. Man kann sich das so vorstellen, dass Ought pieksend und ruckelnd ganz vorne im Luftballon das Gummi ausdehnen und hinter sich her ziehen. Nicht Sisyphos, sondern Antreiber, schon sehr gewillt und ernsthaft, gleichzeitig sleazy scheppernd wie The Fall, Sonic Youth, Wire, Pavement oder Harry Howards Near Death Expirience. Ziemlich krachiger Sonnenuntergang, das, ich mag den Titelsong ganz besonders. Ach, alle Songs hier. Sucht. Immer mehr. Hippeligkeit rules more than OK. Herausragend. Vielleicht das herausragendste Ding hier und heute. Nochmal. Jetzt.
[/half_width][half_width]
Stop
And now something completely not so different: Vollkommen unzappelig, zunächst einmal anders und dennoch genauso berührend gehen The Mynabirds, Rivulets, Tess Parks und Sea Lion an ihre Musikaufarbeitungen heran. Laura Burhenn hat nach ihrer Tourbegleitung von The Postal Service in 2013 und ihrem Sabbatical zurück gefunden zu The Mynabirds und mit dieser Band ein weites Spektrum von Ideen und Einflüssen eingefangen und in die zwölf Songs von Lovers Know gegossen. Das reicht dann tatsächlich von Anleihen in der Traurigkeit und dem bekümmernden Bombast von Lana Del Rey, dem Stehauffrauenhaften bei Kate Bush bis zu merkwürdigen Elementen von HipHop, R&B, Soul und retrofuturistischen Sounds. Dahinter schimmern durchaus leises Feedback und vorsichtiges Shoegazing durch, und Semantics führt fast zum Anfang dieser Kolumne und Summer Camp zurück, die stärkeren Momente sind die Del Rey ähnelnden wie der Abgesang Hanged Man. Im Tempo in vielen Songs ähnlich schleichend, nicht umsonst sind die amerikanischen Slow-Indierocker von Low große Fans von ihnen, sind die Rivulets. Da sind wir wieder beim Thema Erinnern und Vergessen, Recht auf Vergessen, Totalerinnerung durch Totalspeicherungsmöglichkeiten, eine Horrorvorstellung: I Remember Everything heißt das Album, welches zunächst nur auf Vinyl erschien. Alan Spawhawk von Low bescheinigt seinen Landsleuten, eine Vision zu haben. Alleine schon das herzerweichend schöne Tribut Ride On, Molina, welches eine Huldigung des leider vor zwei Jahren zu jung verstorbenen Songwriters Jason Molina (Songs : Ohia, Magnolia Electric Co.) darstellt. Und ihn feiert. Haltung galore. Into The Night bereitet den dunklen folky Weg. Hier wird gelitten, das hilft. Tatsächlich scheinen Acts wie Low oder Songs : Ohia die Blaupause für die Rivulets, ohne dass diese nun abkupfern würden. Mich haben sie. Auch Tess Parks – hier mit Anton Newcombe von The Brian Jonestown Massacre kongenial musikalisch verpartnert – geht eher langsam, schlendert, warum sollte man auch laufen? Alan McGee von Creation Records und Biff Bang Pow!, die man unbedingt mal wieder ausgraben sollte (s.u.), wenn man auch auf die Rivulets und erst Recht Frau Parks steht, hat das aus Toronto nach London gezogene Model mit entdeckt und sie mit Newcombe zusammen gebracht. Schnell wurde Parks zum Musikpresseliebling, an mir gingen sie und ihr zugegeben ziemlich feines Blood Hot-Album langsam vorbei, die Lady machte sich erst jetzt durch ein paar Songs im Radio bemerkbar. Die Attraktion durch Sound finde ich angesichts des bei Parks erwartbaren Reizes im Rahmen des visuellen Modelkontexts um so schöner. I Declare Nothing, das neue Album, ist in der Attütüde rock’n’rolliger, im Sound psychedelischer als Mynabirds, Rivulets oder Sea Lion, hat Dreck am Stecken, auf die angenehme Art und Weise und nur ganz leicht, scheint den ganzen Kontext um Sex und Drogen und Pipapo zu kennen. Dadurch stellt sich fast schon eine Art von Coolness ein, wie sie einst durch Mazzy Stars Hope Sandoval gesetzt wurde. Denen nähern sich Parks und Newcombe sehr an, etwas rumpeliger und heiserer freilich. Parks ist jünger, sie hat den Vorteil noch ganz viel musikalisch (!) ausprobieren zu können. Mit Wehmut als kanadisch-britische Songschreiberin zu beginnen ist wahrlich kein schlechter Auftakt. Man soll ja nicht mit Referenzen zuschütten, so dass erst zukünftige Archäologen wieder freilegen können, aber eine kleine Schippe Spacemen 3 (oder auch The Telescopes, s.u.) darf ich wohl dazu tun, einerseits als absolut herausragenden und kaum zu überhörenden Bezug, hier vor allem die frühen Sonic Boom, Jason Pierce und Co., bitte mal Peace Defrost anhören und dann zum Album Sound Of Confusion der Birminghamer Ex-Drogenbarone wechseln. Geschliffener und schon sehr viel sauberer (was nicht automatisch mit ersterem einhergehen muss), klingen da Sea Lion. Und anders. Auch wenn das Intro noch an Feedbackschlaufen erinnert, wir von Ängsten und Sorgen und Sternen hören, so bewegt sich Linn Osterbergs Projekt deutlicher an Chan Marshall oder verlangsamter Nive Nielsen, Agnes Obel entlang. Schön, zurückgezogen, ja, auch schon intim, wirkt das – und wird von Osterberg auch selbst betont, etwa bei ihrem Songschreiben in Isolation. Wobei das schon bemerkenswert ist: Wieso sind Gitarre, Frauenstimme und offenbar erfahrungsgesättigte Lyrics gleich wieder persönlicher als der neueste Breakbeat- oder Dubstep-Shit? Sea Lion jedenfalls sind da ruhend und in diesem Sinn unbekümmert. Kleine Stücke wie Plains werden dennoch hoffentlich nie in Umkleidekabinen oder zum After-Work-‚Proseccöchen’ gespielt. Es sei denn, um die Leute aus dem Konsumwahn herauszukatapultieren.
Vorweg nach hinten in Sachen Krach
Das eher leise Feedback der Alben von Sea Lion, Parks, Rivultes und Mynabirds wird nun lauter, zudem haben wir hier eine Herausforderung der besonderen Art vorliegen, wenn nämlich alte Helden von gestern, unverschämt freche, fordernde, wegweisende Helden von gestern, es fünfzehn oder zwanzig oder noch mehr Jahre später nochmal wissen wollen. Das kann bekanntlich, man höre nur die fürchterlichen Versuche etwa der Gothic-Rocker Bauhaus oder, ganz anderes Genre, den schlimmen Bunken-Skrillex-Breakbeat von Squarepusher, absolut ungenießbar und überflüssig, also irrelevant, werden. Ähnliches befürchtete ich eher bei The Jesus & Mary Chain als bei den Membranes oder Telescopes. Letztere beiden haben komplett neue Alben eingespielt und schließen völlig unaufgeregt und doch irgendwie zornig, krachend, an ihre letzten und vorletzten Veröffentlichungen an. Die Membranes aus Blackpool sind so eine, naja, fast eher Post-Punk- (klingt auch besser) als Punk-Band, die irgendwie immer dabei waren, gleichzeitig dann verschwunden, seit einigen Jahren wieder zurück und nach zwei E.P.s nun mit ihrem ersten Album in Albumlänge seit Ewigkeiten zur Stelle. Dark Matter/Dark Energy ist nicht schön. Will es auch nicht sein. In verschmutzter, holpriger Nachbarschaft zu den ebenfalls weiter und wieder existierenden Landesgenossen von Wire sägen sich auch die Membranes durch ihre langen, zähen Songs wie The Universe Explodes Into A Billion Photons Of Pure White Light, benannt nach einem Treffen mit dem Leiter des Higgs-Boson-Projekts; das neue Album wird dieser Tage in Estlands Hauptstadt Tallinn tatsächlich mit einem Chor plus Konversation mit dem CERN-Forscher Umut Kose aufgeführt: The Universe: Explained, man beschwere sich also bitte nicht über zu wenig Überbau. Gefallen klingt anders. Das ist für mich viel wichtiger, als die Tatsache, ob man diese Band schon kennt oder nicht. Psychedelisch ohne Hippietum, Mantren werden in die Ohren gedreht, und gute Laune geht anders. Es ist so einfach, zu beeindrucken (u.a. übrigens auch ihre Anhänger wie Kevin Shields von My Bloody Valentine, Grasshopper von Mercury Rev oder Stuart Braithwaite von Mogwai). Ich gehöre nunmehr dazu, knapp vierzig Jahre nach Bandgründung. Gänsehaut in alle Richtungen. Ähnliches gilt für das 35 Minuten kurze Hidden Fields der Telescopes, das zeigt, wieso die Briten damals direkt hinter Primal Scream (in deren noisig-psychedelischer Variante), Loop, Spacemen 3 und The Jesus & Mary Chain (und eigentlich auch den Membranes) aufgelistet wurden und die selbst Acts der darauffolgenden Generation wie Slowdive oder Ride Raum als Vorbands gaben. Einzig ihre teilweise doch kaum zu überhörende Ähnlichkeit mit den Songs und Attitüden der Spacemen 3 und der Loop (höre hier etwa Absence) hat einen für mich auch heute wieder komischen Beigeschmack. Fünf teilweise sehr lange, ausufernde Songs signalisieren dennoch auf jeden Fall kreischende Kompromisslosigkeit, gipfelnd im über 15-minütigen The Living Things. Der bereits erwähnte Grasshopper, der einst mit die Spacigkeit der Flaming Lips bestimmte, dann das damals neue Projekt Mercury Rev gründete, welche für mich immer eine Art Pink Floyd des Indie waren, hat mit The Light In You seit über zwei Jahren an den neuen Songs seiner Band gearbeitet. Es lohnt sich, Mercury Rev wirken, als hörte man durch ein akustisches Kaleidoskop. Ein wenig fehlen mir die leicht durchgeknallten Momente, wirkt das alles doch sehr angenehm orchestral und engelschorgleich (Amelie). Seufz. Und noch eine Anmerkung, wenn nicht hier, wo dann. Mercury Rev haben einst die wohl schönste Coverversion des eh schon feinen Songs Silver Street von Nikki Sudden/Dave Kusworth aka The Jacobites aufgenommen (sorry, dearest Jeremy Gluck!), zu hören etwa auf der Compilation The Essential. Nun noch einen Schritt zurück mit dem legendären Creation-Label von Alan McGee, welches uns einst The Jesus & Marcy Chain, The Pastels, Primal Scream und (viel später) Oasis näher brachte und eine komplett eigene Ästhetik in Covern, Sounds und Haltung entwickelte. Die Ausgabe des verhuschten Brit Pop-Nerds, nicht nur, aber durchaus oft männlich, wurde hier in allen Versionen mitentwickelt. Kein Wunder, dass es jetzt gleich ein 5-CD Box Set der frühen Jahre zu bestaunen gibt, bei dem klar wird, dass Neuentdeckende wohl kaum derart viel Energie und Geld investieren. Hm, ein wenig fühlt man sich als Zeitzeuge in seiner Indie-Geldbörsenehre erwischt. Superschön gemacht, toll verpackt und natürlich auch wundervoll, den C-86-Gitarrenpop der Pastels, Membranes (jaha), Primal Scream, von The Loft oder den Jasmine Minks (nochmal) zu hören. Wenn dann noch Extras dazukommen, sich die Three Johns, McGees Biff Pang Pow! oder die wunderbar irren Television Personalities mit etlichen Songs dazugesellen, fühlt sich das schon spannend an und sollte das auch weiter gereicht und schon auch wieder gehört werden. Ich freue mich auf den zweiten Teil mit My Bloody Valentine, The Jazz Butcher und Nikki Sudden/The Jacobites. Dahingegen erschienen einige der letzten Lebenszeichen der absoluten Trendsetter der Feedback-Süße und schwarzbebrillten Bocklosigkeit, The Jesus & Mary Chain, zuletzt eher mau. Insbesondere die fahrigen Auftritte von Jim Reid hatten eben nichts mehr von der jugendlichen Zerstörungswut, eingerahmt in sweete Melodien und ganz viel Im-Kreis-Drehen, sondern eher leider Fremdschämen zum Anlass. Überraschend energisch ist dieser Live-Auftritt, bei dem das legendäre Debütalbum der Band, Psychocandy nochmals aufgeführt wird. Auch wenn diese Alben-Showcases seltsam nostalgisch und dementsprechend vorhersagbar anmuten, so bietet das tatsächlich nur am besagten Album orientierte Konzert durchaus einen (Wieder-)Einstieg in den Kosmos dieser einst tollen Band und hilft hoffentlich, dass sich noch viele Menschen in den Klassiker Psychocandy verlieben.
Zurück ins Morgen in Sachen Weltpopmusiken
Irgendein Gefühl sagt mir, dass Angel Deradoorian aus Los Angeles, die ansonsten bei den Dirty Projectors gespielt und zuletzt auch für Flying Lotus gesungen hat, die eben genannten Bands durchaus schon mal gehört hat oder sogar mag. Allerdings lässt ihr tolles erstes Soloalbum The Expanding Flower Plant auch ahnen, dass ihr neben unpeinlichen neuen Weltmusiken – oder nennen wir es transnationalen Popmusiken – vor allem Krautrock der Prägung Can oder Neu! zu Ohren gekommen ist (A Beautiful Woman). Deradoorian hat sich zwar die eine oder andere Hilfe geholt, doch das meiste hier ist von ihr selbst geschrieben und eingespielt, was einen noch mehr staunen lässt. Im Grunde hat es das neue Label Anticon bereits hoffen lassen, welches schon so unterschiedliche Acts wie u.a. 13 & God, Beans, Baths oder Son Lux gesignt hat und Stilistiken zwischen Indie, Folk und HipHop verbindet. Deradoorian öffnet sich, geht viele neue und doch auch konsequente Wege und begeistert mit ihrer offenen Suche. Sóleys neues Album Ask The Deep könnte auch auf Anticon erscheinen, hat mit Morr Music aber natürlich auch so schon ein kompatibles Label. Zwischen beiden Plattenfirmen gibt es übrigens durchaus einige Überschneidungen. Das sei den Recherchefreudigen hier überlassen. Ich hätte Sóley Stefánsdottirs nunmehr zweites Album auch in der Sektion um Sea Lion und Tess Parks erwähnen können, denn sie betreibt schon mehr melancholisches Songwriting als Weltmusik oder Indietronica. Und doch scheint die Isländerin so etwas wie angenehmen Rock, New Wave oder auch Post Punk intus zu haben. Gleichzeitig experimentiert sie sehr wohl auch hier wieder mit Sounds und Stilen, weswegen sie sehr gut zwischen Deradoorians, Naked Lunchs, Inventions’ und Braids’ Musik passt. Sóley bleibt dabei die Traummusikausgabe von Eskapismus. Die wunderbaren Naked Lunch aus der Stadt der Klage im Süden Österreichs (in der Naked Lunch eines der popmusikkulturellen Highlights darstellen) haben irgendwann, in den ganz frühen Neunzigern, ebenso wie The Notwist, im Zuge von Grunge angefangen, US-Bands zu supporten. Es hat eine Weile gedauert, bis sie zu großartigen Alben wie zuletzt etwa Universalove Soundtrack (2009, auch ein Soundtrack) und All Is Fever (2013) zu Höchstform aufliefen. Die Multitalente, die mittlerweile nicht nur auch Filme vertonen, sondern Theaterstücke schreiben, mitspielen, in der Kunst unterwegs sind etc. haben auch die Musik zum österreichischen Psychogramm über die Rückkehr eines Mörders in die Wiener Society mit Johannes Krisch in der Hauptrolle geschrieben. „Ein einziger großer Glücksfall“, sagt die Band dazu. Man möchte nickend zustimmen, denn auch Jack funktioniert sowohl als auch, das berührte ja bereits bei Universalove so. Wobei die hiesigen elf Songs eher Skizzen als vollständige Stücke sind. Gerne reißt ein Song wie Weeping Dog nach knapp zwei Minuten ab, wirken andere Stücke wie So Warm Today karg und beinahe wie auseinanderfallend, bewegt sich alles zwischen Folk, Indietronics und doch auch immer wieder Rock’n’Roll. Naked Lunch können geizen. Und machen (wieder mal) umso neugieriger. Als mehr als Ableger von Explosions In The Sky (Mark T. Smith) und Eluvium (Matthew Cooper) haben sich Inventions verändert. Gegenüber ihrem gleichnamigen Debüt 2014 (siehe Kolumne #01) wirkt Maze Of Woods geradezu verspielt. Irre, was sich hier in allerlei Richtungen wie Electronica, TripHop, Sampling Ambient weiter entwickelt hat. Es mag esoterisch klingen, doch dass dieses Album von dem Duo an der Küste von Oregon abgemischt wurde, hört man heraus. Denn Weite im Sinne von Möglichkeiten, durchzieht hier jeden Songtrack bzw. Tracksong, je nach Gewichtung des mal eher Song schreibenden oder Track bastelnden Ansatzes. Auch hier wieder, mal breit fließend (Peregrine), mal eher konzentriert (Escapers) kommt eine für mich zentrale Funktion von Popmusik sehr frei und intensiv zum Zuge: Trost.
Nun aber mal (noch) elektronisch(er)
Witzig, als seien Naked Lunch, The Jesus & Mary Chain oder Rocko Schamoni nicht elektronisch. Und überhaupt, wie soll denn eine Steigerung dessen funktionieren? Inventions? Jedenfalls bilden sie mit ihrem Zweitling den idealen Übergang zu einer Sektion mit mehr aus der elektronischen Tanzmusiktradition stammenden, diese aber auch erweiternden Sounds. Der Exil-Hamburger Fenin bringt mit seinem seinem fünften Album Lighthouse wieder Schub in die länger unauffällige Berliner Minimal-Dub-Techno-Ecke. Ob nun Dub genretheoretisch und musikalisch immer zutrifft, sei dahingestellt, als Label funktioniert es. Basic Channel, Daniel Meteo, Kit Clayton und kultürlich der gleich nochmals genauer erwähnte Stefan Betke aka Pole haben hier vor allem in den Neunzigern und um die Jahrtausendwende (klingt immer noch fulminant, ich meine, wir haben das miterlebt!) bei vielen ehemaligen Indie-Freunden nach Drum’n’Bass/Jungle die nächste Welle postmoderner Tanzmusik losgetreten. Genau zu dieser Zeit begann Fenin mit seiner ersten E.P. Herr Pitzelberger dreht auf. Mit neuer Software und um einige Erfahrungen reicher zappelt sich Fenin mittlerweile unglaublich geschmeidig über den Tanzboden, fließt sofort in die Beine, selbst ehemals gebrochene Füße wackeln directement los. Poles Störgeräusche und im weiten Sinne Produktionsprozessfehler haben ihn in bestimmten Kreisen weltberühmt und zum sehr begehrten Produzenten, Mastering-Experten oder Berater gemacht. Seine drei Farben-Alben, die später nochmal als Dreifach-CD wiederveröffentlicht wurden (1,2,3, schwarz, rot, gelb), bleiben für mich absolute Inselplatten. Wenn ich Außerirdischen erklären sollte, wie wir, hier, mitten in Germany, 1999 klangen, ich würde ihnen diese drei Alben des gebürtigen Düsseldorfers in ihre vegetativen oder maschinellen Systeme jagen. Nach dem Steingarten in 2007 nun der Wald. Betke hat sich Zeit gelassen. Wolfgang Voigts Gas hat den Königsforst berauschend vertont, nun nimmt sich Pole dem Gehölz vom Titel her noch abstrakter an. Dass Pole auch mit Nationalfarben und -motiven spielt, ist kaum zu übersehen und kann angesichts gesamteuropäischer Debatten um Willkommenskultur und pöbelnde Idioten, die Flüchtlingsunterkünfte bedrohen, schon ein wenig seltsam wirken. Betke wollte andererseits schon immer irritieren, spielen, in jeder Hinsicht Brüche, hier scheint sich eine, vielleicht ästhetische, Konstante durchzuziehen und vielleicht ein kleines Augenzwinkern anzudeuten. Auf Wald versammeln sich u.a. die zuvor als drei E.P.s veröffentlichten Vorstudien namens Waldgeschichten. Was für ein wunderbarer, unheimlicher Robotermaschinenwald. Wo Gas dann doch den Mythos Wald evoziert, springen bei Pole die Bits und Bytes durch das Unterholz. Manchmal, wenn es bricht und knackt, scheinen die drei Kultalben wieder durch (Salamander). Und das macht Spaß, kein Zweifel. Sucht man sich die fröhlicheren, unbeschwerteren Phasen von Wald heraus (ja, Pole ist leichter, vielleicht erleichterter geworden), könnte man den Mix sogleich in eines der Stücke von Braids aus Calgary und Montreal übergehen lassen. Dieses Album darf nicht übersehen werden! Weniger stampfend, weniger wälzend als die immer noch tiefen Bässe von Pole beginnen die Dinger des kanadischen Trios zu hüpfen. Nur nicht niedlich finden. Genauso wenig wie Pole poliert zu finden ist. Braids sind denn dann doch mehr Songwriting, Letting Go eine kleine springende Irgendwastronica-Hymne. Braids passen an diese Stelle wesentlich besser als zu den zunächst einmal genauso mit ihrer Soundästhetik zusammenhängenden Indies und Shoegazern. Vor fünfzehn Jahren würde man das brandheiß Indietronics genannt haben und mit Acts wie The Postal Service, Lali Puna, The Notwist oder Console in Verbindung bringen. Dafür, höre Taste, sind die Braids fast schon zu poppig oder, höre Blondie, zu drums’n’bassig. Bei Miniskirt treffen Indie-Hopper gar auf ganz großen Mainstream-Bombast, die verunsichern mich hier, die Braids. Hier wird nicht auf den Boden geschaut, hier wird in die Luft gesprungen. Wo wir schon gerade in den späten Neunzigern waren, sei mit dem nach langer Pause als Funkstörung gleichnamig betitelten Comeback-Album an die Bedeutung des Duos Chris De Luca und Michael Fakesch erinnert. Bei mir befanden sich deren Tracks immer neben Autechre, Aphex Twin, Clark auf der einen und hoppigeren Acts wie Gonzales oder Peaches auf der anderen Seite. Im innovativen Soul und Funk waren Funkstörung zusammen mit Super Collider ganz vorne. Kein Wunder, Jamie Lidell von dem schon lange aufgelösten Projekt mit Cristian Vogel steuert auch hier auf Funkstörungs neuem Album den mit Abstand coolsten, größten Hit bei. So Simple würde ich sofort nochmal und erst Recht wieder auflegen, vielleicht sogar zum Runterkommen nach Blondie der Braids. So furztrocken und gleichzeitig basslastig und also supersexy können das nur Lidell und die Funkstörung. Der Track genügt. Drumherum und featuring diverse weitere Gäste wie Jay-Jay Johanson, Audego, Anothr, ADI und Sweezee wirkt das alles sehr professionell und durchdacht. Nicht schlecht, nur wenig überraschend. Von der im positiven Sinn Kurzatmigkeit und Durchdachtheit dieser Acts hat Holly Herndon, die mittlerweile von Musik- zu Kunstfestival zieht und auf sehr breiter Ebene gefeiert wird, eine ganze Wolke eingeatmet. Ich war nach all den Vorschusslorbeeren und dem ersten Album Movement sehr gespannt auf Platform. Dann enttäuscht. Doch Ent-Täuschung kann ja erkenntnisreich sein. Dann immer wieder und vor allem konzentrierter zugehört. Nicht nebenbei. Das funktioniert nicht bzw. lässt Herndons zerschnippselte Opern dann wirklich ins Bedeutungslose Hintergrundrauschen versinken. Nein, Herndons kleine vollgesamplete Monsterchen brauchen Aufmerksamkeit. Schenkst Du sie ihnen, dann belohnen sie Dich mit der schönsten klanglichen Computerliebe seit langem. Jens Balzer hat das neulich in der Frankfurter Rundschau mal wieder sehr treffend „Ein Liebeslied für die NSA“ (Balzer 2015: 32) genannt. Die Cyborgspione weinen sakral, ja, das ist ja der reinste digitale Gospel hier (Morning Sun). Noch hektischer ist dann nur noch Hudson Mohawke, der mit Butter vor sieben Jahren Standards in Brüchen und Klangästhetiken gesetzt hat und deswegen auch zum sehr gefragten Produzenten und Kollaborateur für große Stars geworden ist, am intensivsten sind seine Zusammenarbeiten mit Kanye West dokumentiert. Die restliche Liste liest sich mit u.a. Antony & The Johnsons (der hier auf Indian Steps auch kopfbestimmt singt), Björk, R. Kelly oder Drake nicht minder exotisch. Wobei das gar nicht ahnen lässt, wie vertrackt Hudsons eigene Track-Produktionen so sein können. Neben Flying Lotus ist Mohawke für mich einer der strahlendsten Musiker der ganz wirren Sounds und Beats. Und das bleibt er mit Lantern auch. Wenn Flying Lotus Miles Davis ist, dann dürfte Hudson Mohawke Prince sein. Trashiger, überblasener und dennoch absolut kalkuliert, nicht negativ gemeint, ich musste schon beim dritten Track Ryderz unweigerlich an den tollen Film und (wie immer) noch tolleren Soundtrack Bling Ring von Sofia Coppola denken. Das Luzide des Vorstadtplattenbaus, augenzwinkernd, aber nie blöd-ironisch aus Feigheit. Hier wird schon sehr intelligent geprollt. Wow. Da staune ich. Positive Rastlosigkeit und wohl dosiertes Experiment bei gleichzeitigem Grundvertrauen in die Macht der Melodie stehen für mich auch für Barbara Morgenstern, die mir vor Jahren, also gewissermaßen in ihrer Hochphase des Eingebundenseins in die Berliner Tanz- und Clubmusiken, schon berichtete, dass für sie eigentlich alles am Piano beginnt (und endet). Raus aus Hagen, werde Indie-Popstar. Vorab erscheint die E.P. Beide mit Versionen und alternativen Songs, dann kommt das ganze Album Doppelstern, Barbara Morgenstern war (fast) immer mit Berlin und nicht ihrer Heimatstadt Hagen verbunden, sie stand für Wohnzimmerkonzerte, Billigelektronik-Equipment, ohne jemals trashig sein zu wollen. Eher im guten Verständnis alternativ, sie war und ist die Pop-Queen des guten Geschmacks und manche Songs haben mir aus diversen Gründen schon die Tränen in die Augen gejagt. Wenn auch Sympathie, Empathie und Bescheidenheit auf Dauer als Zuschreibungen evtl. nerven können, halte ich das für ein absolutes Kompliment. Noch schöner, dass Frau Morgenstern nun durchaus mal dick auffährt und viele Gäste dabei hat, die gemeinsam mit ihr die Songs verantworten, ausnahmslos spannende Leute wie auf der E.P. erneut Robert Lippok und Schneider TM, auf dem Langspieler Richard Davis, Hauschka, Justus Köhncke, T.Raumschmiere, Gudrun Gut oder die bezaubernde Lucrecia Dalt, die eher irritiert wirkte, als ich sie nach einem phantastischen Konzert darauf ansprach, dass sie für mich musikalisch ein Update der coolen Elemente eines Sounds, der mal für den New und No Wave von Brüssel stand, verkörpere, wohl bemerkt in der 2.0-Version. Diese Vernetzung innovativer Leute passt zu Morgenstern. Eigentlich auch alles egal, weg mit den Kontexten und wieder nur auf das Eigentliche konzentriert: Seit Vermona ET 6-1 von 1998 ist sie bei Gudrun Guts Label Monika Enterprises, und Doppelstern ist ein echtes Best Of in Form gänzlich neuer Songtracks und belegt, wie zeitlos Morgensterns Stücke sind. Die Welt wäre eine bessere, wenn noch mehr Menschen Barbara Morgenstern hören und mögen würden: Gleich ist gleicher als gleich mit Lucrecia Dalt. Dazu mal soviel. Und dann Facades mit Julia Kent. Ein Universum.
Fading out…But von wegen.
Ähnlich sanft und doch messerscharf und zentnerschwer im Nachgang wie das genannte Himmelreich Barbara Morgensterns können die Songs von Julia Holters viertem Album Have You In My Wilderness wirken. Wenn auch im Ansatz verschieden, so sind die deutlicher am guten Pop denn an elektronischer Musik orientierten Songs der in Los Angeles lebenden Musikerin ähnlich berührend. Wo Morgenstern für mich allerdings noch näher an Gudrun Gut oder auch Nico, wenn auch sicherlich Hoffnung spendender, klingt, kommen einem bei Holter sehr schnell ehemals verschüttete Genies wie Linda Perhacs (in deren Band sie auch schon spielte) oder Laura Nyro in die emotionalisierenden Sinne. Wo Morgenstern an Techno, Dub, Indietronics entlang schreitet, produziert Holter einen löblich verhuschten Indie Soul, wie ich ihn derzeit nur beim leider verstorbenen Briten Epic Soundtracks und den gerade genannten Musikerinnen hörte. Getroffen wird sich am Klavier und im Song. Holter hat hier die Essenz ihres bisherigen Schaffens erzielt, einfach immer wieder anhören: Sea Calls Me Home, da darf sogar ein Saxophon auftreten. Schräger und mit seinem Vorgänger-Album Salad Days nur so ein bisschen hängen geblieben, trieb mich das schlechte Gewissen in die Arme von Mac DeMarco. Erneut. Und was für ein Glück! Im Grunde spreche ich mich hiermit auch nochmal ausdrücklich für Salad Days aus dem Jahr 2014 aus. Ich muss beim Erblicken des Kanadiers immer an den irren Bruder Billy von Brenda in der makaber-trockenen TV-Serie Six Feet Under denken, was zweifellos unfair ist. Aber auch ein ‚brain catcher’ in Zeiten voller Musik. Anyway, blöder Anklang, Demarcos Songs schwirren zwischen Anti Folk, Homerecording, Pavement und – ganz immens bedeutend – seichtem Westcoast und Soul umher und treffen in einer kargen Variante dann auf die opulenteren Stücke von Holter, als Package nahezu ideal für Anti-Soul-Soul zum Einsteigen, im Fall von DeMarco mit einer gehörigen Prise (Achtung!) John Lennon und Michael Franks. Ha, jetzt weiß ich es, DeMarco könnte im Cabrio fahren, mit dem Billy sleazy aus der Klappse entflohen, um endlich wieder mit einem Messer in die Arme seiner Schwester zu fallen. Wiedervereinigung mit Schmerzen, Flucht mit debilem Grinsen, alles untermalt von den tollen Songs DeMarcos. Da hinein sollte doch nochmal etwas krachen, wenn beim Thema Autofahrt (hahaha, Achtzng, Wortwitz und toll gestelzte Überleitung) natürlich auch die Band Autobahn naheliegt. Hm. Deren Dissemble setzt schon klar eher bei dunklen postpunkigen Briten der achtziger Jahre an, Red Lorry Yellow Lorry, Honolulu Mountain Daffodils etwa oder die schon genannten frühen Sisters of Mercy oder The Three Johns. Dass Städte und Regionen Sounds prägen, wundert hier nicht, denn Autobahn kommen, wie die meisten der Referenzen, aus der nordenglischen Industriestadt Leeds und bauen einen ausgemergelt-düsteren Wall Of Sound auf, der einen treibt. Fast an die Membranes heran. Toll angespannt und schlecht gelaunt. (In Klammern: Eigentlich klingen Autobahn total nach den tollen Karies oder Nerven aus Deutschland.) Bis man schlaflos wird. Und vom Seelenklempner Billy dann Simon Scott verschrieben bekommt und alles wieder von vorne losgeht. Simon Scott, mit Neil Halstead einst bei den mittlerweile etwas überhöht als Shoegaze-Götter mystifizierten, wenn auch fraglos wichtigen Slowdive aktiv, hat seine Nische im Soundexperiment und Ambient gefunden und fiel dementsprechend zuletzt durch tolle Beiträge in der wunderbaren Reihe Pop Ambient des Kölner Kompakt-Labels auf. Nach 23 Minuten (es gibt zwar Tracktitel, doch das Album spielt und fließt in einem Track) verwandeln sich auf Insomni Rauschen, Schweben und Distortion dann in eine akustische Gitarre mit an Field Recordings erinnernden Geräuschen im Hintergrund. Scott hat sich vom Schlagzeuger zum Komponisten voran entwickelt, Insomni ist bei mir in die ‚slow rotation’, also langsam wechselnd, langsam spielend, geraten. Und nun verlangsamt es sich weiter, und es wird leiser. Wenn auch erstmal nur ein Stückweit. Dass leiser nicht wirkungslos heißt, zeigte sich beeindruckend vor knapp zwei Jahren auf dem phantastischen Madeiradig-Festival (vgl. auch die Beiträge zum letztjährigen Festival hier in der „Aufhebung“), als an einem Abend die brachialste Künstlerin (Pharmakon) auf Grouper (aka Liz Harris) traf. Liz Harris hat mit Jed Bindeman, Scott Simmons und eben einer Helen die Band Helen gegründet. Nicht weit entfernt von Grouper testen eben diese das Leise aus. The Original Faces zerbricht fast, verschwindet beinahe, so wie Grouper damals beim Konzert auf der Blumeninsel hinter dem Equipment Desk. Noch leiernder, mit grobem LoFi-Touch, suchen Helen den Song, das alles wirkt zunächst nicht nach einem jahrelangen Aufnahmeprozess in Portland. Durchgehend leise ist das auch nicht, denn einige Songs sind feedbacklastig, kreischen durchaus, das beginnt schon nach dem Intro auf Ryder. Grouper hat Kraft und Pop getankt, lässt los, bleibt gleichwohl immer noch zurück und in sich gezogen und heißt nun Helen. Dying All The Time landet dann wieder sogar bei frühen Yo La Tengo oder fast bei aktuellen Autobahn. Alles ziemlich schön. Bei Helens Labelmate Steve Hauschildt dann wird auch der Rhythmus deutlich verschleppt und verlangsamt, Soundwolken sind das mehr als zu präzise fassende Landschaften. Majestätisch, kosmisch und doch kleinmaulig gleiten die Sounds des jungen Amerikaners und Ex-Emeralds durch unser Gehör, setzen sich sanft fest. Stars Of The Lid, A Winged Victory For The Sullen, das Bersarin Quartett oder viel früher Tangerine Dream lassen in Zeitlupe grüßen. Ziemlich leuchtend und gleichzeitig gedämpft wachsen die zumeist langen, ruhigen Tracks von Hauschildt und erlangen Größe. Ruhe in Frieden. Nicht ganz. Vielleicht doch ein Toxoplasma? Oder Post-Ambient und Kosmische Musik? Dafür aber wieder nicht hippiesk genug, was genau den Reiz von Hauschildts instrumentalen Raumschiffen ausmacht. Steigen wir ein, um auszusteigen. Zumindest für eine Weile.
So weit, so gut. Oder?
So viele Platten, die umher schweifend eingesammelt und kommentiert wurden. Dennoch nie um irgendwelcher Zahlen oder Zählungen oder gar um des PR- oder Marketing-Effektes wegen, Motive, die der britische Politikwissenschaftler Colin Crouch im Rahmen seiner radikalen Kritik am Neoliberalismus sachlich analysiert und dann frenetisch attackiert (vgl. Crouch 2008, 2011, 2015). Sondern – ganz trivial – weil das hier geht, motivunverdächtig, ohne gleichzeitige Anzeigenschaltung, sehr wohl redigiert, letztlich aber doch auch einfach so. Der österreichische Philosoph und Kunsttheoretiker Gerald Raunig (2012: 35) beschreibt die Gefahr der Maßregelung für das wissenschaftliche Nachdenken passend kritisch: „Wildes und transversales Schreiben wird gezähmt und zum frühestmöglichen Zeitpunkt in die Kreativitätsvernichtungsapparate der disziplinären Institutionen eingespeist.“ Dagegen darf und möchte ich anschreiben. Mich motiviert das, diese Art von Kritik an Popmusik mit gesellschaftlicher Beobachtung zu verbinden, ein bisschen mehr politischen und politisierten Diskurs zwischen Agonistik im Sinne von Chantal Mouffe (2007) und Kollaboration im Sinne von Terkessidis (2015a) zu wagen, gegen eine Pseudokritik (vgl. Behrens 2013), für ein ‚qualified self’ im Sinne des Kunstwissenschaftlers Jörg Scheller (2015), das tut mehr als Not: „Wir schauen alle zu, und wir sagen nichts“, singt Barbara Morgenstern immer wieder holend in Too Much… Pop kann dabei helfen, Pop muss aber auch geholfen werden, von alleine läuft hier nichts: „Sind aber viele Popwelten zugleich Ausdruck einer gesellschaftlichen Selbstdeutung, in der einer breiteren Öffentlichkeit bestimmte Kulturbefindlichkeiten ihrer selbst entgegenkommen können, dann liegt die Überlegung nicht fern, als Konsequenz aus der Etablierung der gesamtgesellschaftlichen Kulturbühne ‚Pop’ deren Ausdrucksformen bewusst zu machen und gleichsam ‚didaktisch’ für unsere Selbstreflexion zu nutzen.“ (Steenblock 2008: 236) Der Herausgeber der „Aufhebung“, Robert Henschel (2015), versucht ähnliches, meines Erachtens nach sehr eloquent und wurde dafür zu Recht prämiert.
Ich hoffe, ein weiterer kleiner Blick auf das popmusikalische Gestern, Jetzt und Dann ist mir damit halbwegs gelungen. So far…from now on… Es gibt schließlich vorläufig mehr tolle und schlechte Popmusik denn je. Die Diskursmasse wächst in ihrer verfügbaren Hörbarkeit letztlich ständig, synchron sowie diachron. Ist das nicht wunderbar? „Knowledge is power.“ (Fiske 1989: 175)
Abspann 1: (Mal wieder) Epic Soundtracks – The Rain Came Down.
Abspann 2: Neulich: „Soll ich Dir die Tasche abnehmen?“ – Dann: Keine Fragen mehr.
Abspann 3: Jetzt noch: Elisa Ambrogio – Stopped Clocks und Comers (ich Trottel, monatelang überhört, unerhört!)
CU then and there and from now on!
[/half_width][/layout_group][/layout]
Text
Christoph Jacke
Fotografie
© Die Aufhebung
[togglegroup][toggle title=“Quellen“]
BALZER, Jens (2015): Ein Liebeslied für die NSA. Gefällt dir, was ich für dich gemacht habe? Holly Herndon und ihr Album „Platform“. In: Frankfurter Rundschau. 71. Jahrgang. Nr. 114 vom 19.05.2015, 32.
BEHRENS, Roger (2013): Kritik: rettend wie rücksichtslos. Das Zeitalter der Kritik als kritisches Zeitalter. In: Kunstforum International. Band 221 (Mai – Juni 2013), S. 164-181.
BERG, Stephan (2015): Zwischen Boom und Krise. Ein Lagebericht über die Museen. In: Forschung & Lehre. Nr. 09/2015, S. 726-728.
BUNZ, Mercedes (2004): Die Utopie der Kopie. In: Maresch, Rudolf; Rötzer, Florian (Hrsg.): Renaissance der Utopie. Zukunftsfiguren des 21. Jahrhunderts. Frankfurt/M.: Suhrkamp, S. 156-171.
CROUCH, Colin (2008): Postdemokratie. Frankfurt/M.: Edition Suhrkamp.
CROUCH, Colin (2011): Das befremdliche Überleben des Neoliberalismus. Postdemokratie II. Frankfurt/M.: Edition Suhrkamp.
CROUCH, Colin (2015): Die bezifferte Welt. Wie die Logik der Finanzmärkte das Wissen bedroht. Berlin: Suhrkamp.
DANKO, Dagmar (2013): Kritik, Vermittlung und Subversion. Kunstkritik in und durch Gesellschaftstheorien. In: Kunstforum International. Band 221 (Mai – Juni 2013), S. 152-163.
DIEDERICHSEN, Diedrich (2015): Genies und ihre Geräusche: Deutscher Punk und Neue Welle 1978-1982. In: Emmerling, Leonhard; Weh, Mathilde; Goethe-Institut e.V. (Hrsg.): Geniale Dilletanten. Subkultur der 19080er- Jahre in Deutschland. Ostfildern: Hatje Cantz, S. 10-22.
DWORKIN, Ronald (2014): Religion ohne Gott. Berlin: Suhrkamp.
FISHER, Mark (2015): Gespenster meines Lebens. Depression, Hauntology und die verlorene Zukunft. Berlin: Tiamat.
FISKE, John (1989): Understanding Popular Culture. London und New York.
HEISER, Jörg (2013): Scharfrichter, Hohepriester und Netzwerker. Eine zeitgenössische Typologie der kunstkritischen Rollenbilder. In: Kunstforum International. Band 221 (Mai – Juni 2013), S. 142-151.
HENSCHEL, Robert (2015): Andere Orte, andere Körper. Zum Verhältnis von Affekt, Heterotopie und Techno im Berghain. In: Samples. Online-Publikationen der Gesellschaft für Popularmusikforschung. 13. Jahrgang. Online: http://www.gfpm-samples.de/Samples13/henschel.pdf (Stand: 10.09.2015).
HOPPER, Julia (2015): The First Collection of Criticism by A Living Female Rock Critic. Chicago: Featherproof.
HÖRISCH, Jochen (2013): Man muss dran glauben. Die Theologie der Märkte. München: Wilhelm Fink.
JACKE, Christoph (2004): Medien(sub)kultur. Geschichten – Diskurse – Entwürfe. Bielefeld: Transcript.
JACKE, Christoph (2005): Zwischen Faszination und Exploitation. Pop(musik)journalismus als Forschungsdesiderat. In: Bonz, Jochen; Büscher, Michael; Springer, Johannes (Hrsg.): Popjournalismus. Mainz: Ventil, S. 49-65.
JACKE, Christoph (2014): Alright or Not? The Kids Have Grown up. Reflexion zwischen Pop, Journalismus und Wissenschaft in Spex. In: Breitenborn, Uwe; Düllo, Thomas; Birke, Sören (Hrsg.): Gravitationsfeld POP. Was kann Pop? Was will Popkulturwirtschaft? Konstellationen in Berlin und anderswo. Bielefeld: Transcript, S. 201-219.
JACKE, Christoph; JAMES, Martin; MONTANO, Ed (Hrsg.) (2014): IASPM Journal. Vol. 4. Nr. 02/2014: „Music Journalism“. Gastherausgabe des Journals der International Association for the Study of Popular Music (IASPM). Online: http://www.iaspmjournal.net/index.php/IASPM_Journal/issue/view/57
JACKE, Christoph/KAVKA, Markus (2015): Zur Not auch die ZDF-Hitparade. Ein Gespräch über Popmusik und Fernsehen in Deutschland. Markus Kavka und Christoph Jacke. In: Greif, Stefan; Lehnert, Nils; Meywirth Anna-Carina (Hrsg.). Popkultur und Fernsehen. Historische und ästhetische Berührungspunkte. Transcript. Bielefeld.
MOUFFE, Chantal (2007): Über das Politische. Wider die kosmopolitische Illusion. Frankfurt/M.: Edition Suhrkamp.
MÜLLER, Wolfgang (Hrsg.) (1982): Geniale Dilletanten. Berlin: Merve.
RAUNIG, Gerald (2012): Fabriken des Wissens. Streifen und Glätten I. Zürich: Diaphanes.
SCHELLER, Jörg (2015): Vom Kunsturteil zum Kunstnurteil. Kritik in Zeiten von Digitalität, Dividualität, Quantified Self und Crowd Criticism. In: Kunstforum International. Band 235 (August – September 2015), S. 65-71.
STEENBLOCK, Volker (2008): Popkultur und Kulturkritik. In: Ders. (Hrsg.): Kolleg Praktische Philosophie. Band 3: Zeitdiagnose. Stuttgart: Reclam, S. 206-239.
TAYLOR, Charles (2013): Die Formen des Religiösen in der Gegenwart. 4. Auflage. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
TERKESSIDIS, Mark (2015a): Kollaboration. Berlin: Edition Suhrkamp.
TERKESSIDIS, Mark (2015b): Streit macht glücklich. In: Spex. Heft 362 (Juli/August 2015), S. 34-37.
WINKLER, Hartmut; BERGERMANN, Ulrike (2003): Singende Maschinen und resonierende Körper. Zur Wechselbeziehung von Progression und Regression in der Popmusik. In: Arndt, Jürgen; Keil, Werner (Hrsg.): Alte Musik und neue Medien. Hildesheim: Olms, S. 143-172.
[/toggle][toggle title=“Platten“]
Summer Camp, “Bad Love”, Moshi Moshi, 2015.
New Order, “Music Complete”, Mute, 2015.
The Silence, “The Silence”, Drag City, 2015.
Rocko Schamoni & L’Orchestre Mirage, “Die Vergessenen”, Staatsakt, 2015.
Schnipo Schranke, “Satt”, Buback, 2015.
Die Goldenen Zitronen, “Flogging a Dead Frog”, Altin Village & Mine, 2015.
Lou Barlow, “Brace the Waves”, domino, 2015.
Bill Fay, “Who Is The Sender?”, Dead Oceans, 2015.
Yo La Tengo, “Stuff Like That There”, Matador/Beggars Banquet, 2015.
V/A – “Dis Cover – Donna Regina as recorded by”, Karaoke Kalk, 2015.
Du Blonde, “Welcome Back to Milk”, Mute, 2015.
Shilpa Ray, “Last Year’s Savage”, Northern Spy, 2015.
The Cairo Gang, “Goes Missing”, Drag City, 2015.
Metz, “II”, Sub Pop, 2015.
Battles, “La Di Da Di”, Warp, 2015.
Ought, “Sun Coming Down”, Constellation, 2015.
Richard Hawley, “Hollow Meadows”, Parlophone, 2015.
The Mynabirds, “Lovers Know”, Saddle Creek, 2015.
Rivulets, “I Remember Everything”, Jellyfant/Popup, 2015.
Tess Parks & Anton Newcombe, “I Declare Nothing”, A Records, 2015
Sea Lion, “Desolate Stars”, Turnstile/Caroline, 2015.
Membranes, “Dark Matter/Dark Energy”, Cherry Red, 2015.
V/A, “The Dawn of Creation Records 1983-85”, Cherry Red, 2015.
The Telescopes, “Hidden Fields”, Tapete, 2015.
Mercury Rev, “The Light In You”, Bella Union, 2015.
The Jesus & Mary Chain, “Psychocandy Live Barrowlands”, Demon/Edsel, 2015.
Deradoorian, “The Expanding Flower Planet”, Anticon, 2015.
Sóley, “Ask The Deep”, Morr Music, 2015.
Naked Lunch, “Music From the Film ‘Jack’”, Tapete, 2015.
Inventions, “Maze of Woods”, Bella Union, 2015.
Fenin, “Lighthouse”, Shitkatapult, 2015.
Pole, “Wald”, Kompakt, 2015.
Braids, “Deep in the Iris”, Arbutus, 2015.
Funkstörung, “Funkstörung”, Monkeytown, 2015.
Holly Herndon, “Platform”, 4AD, 2015.
Hudson Mohawke, “Lantern”, Warp, 2015.
Barbara Morgenstern, “Beide”/“Doppelstern”, Monika Enterprise, 2015.
Julia Holter, “Have You in My Wilderness”, Domino, 2015.
Mac Demarco. “Another One”, Captured, 2015.
Autobahn, “Dissemble”, Tough Love, 2015.
Simon Scott, “Insomni”, Ash International, 2015.
Helen, “The Original Faces”, Kranky, 2015
Steve Hauschildt, “Where All is Fled”, Kranky, 2015
[/toggle][toggle title=“Hör|Spiel“]
[/toggle][toggle title=“Schau|Spiel“]
[/toggle][/togglegroup]
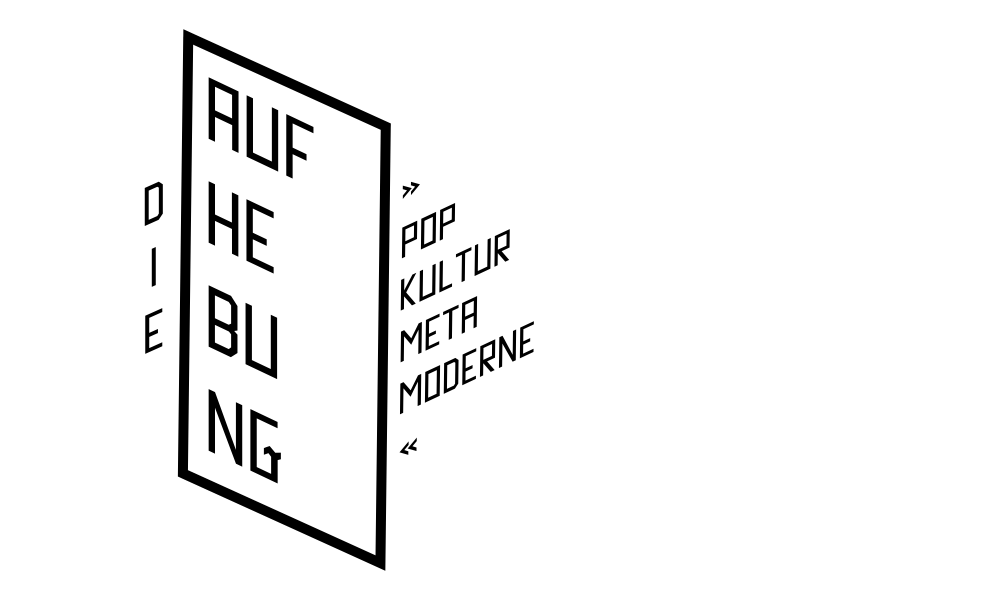


One Comment