Egoismus ist in der Postmoderne keine moralische Kategorie mehr, sondern die notwendige Fokussierung auf das Ich: Alle sind einzigartig und jeder ist dabei mit sich allein.
(Stegemann 2017: 83)
Es tritt Erschöpfung an die Stelle der Schöpfung.
(Reck 2016: 35)
Die letzte Konsequenz des Individualismus ist die Einsamkeit.
(Schindler 2016: 22)
Vorrede:
keine Entschuldigung für die lange Pause – nur für an der Kolumne und ihren Kontexten Interessierte – before so far.
Ich fühle mich frei. Als Journalist. So frei, dass ich einfach mal viele im wahrsten Sinne des Wortes bemerkenswerte popmusikalische Alben gesammelt habe und nun erst kommentieren kann, sie also von ihrer Präsenz in meiner Anlage, auf meinem Rechner, auf meinem iPod und letztlich in meinen Ohren oder besser gesagt in meinem Hirn, denn Ohren hören bekanntlich nicht, wieder in Repräsentation verwandele und zu Zeichen mache. Dabei ist Verlust quasi kultürlich vorprogrammiert, weswegen die Philosophin Sybille Krämer (2008) in ihrer Spurensuche auch für den Blick neben die Zeichen plädiert. Die Möglichkeit des umgekehrten Wegs aber bietet mir Die Aufhebung. Angesichts der Währung Aktualität auch für den Musikjournalismus mutet das eher ungewöhnlich an, wobei hier Zeiten als prinzipiell fast alle Zeiten definiert werden kann. Abgesehen von echten Fanzines und heute eben auch einigen der Fan-Blogs, einerlei ob auf Papier oder Bildschirm, einerlei ob vor 40 Jahren oder heute, denn dort geht es oftmals nicht um Imitation von ›den Großen‹, ›den Profis‹ etc., sondern darum, etwas Eigenes zu machen und dabei, ganz fanatisch wie man/frau/trans/xyz ist, jenseits von Veröffentlichungslisten, Tourdaten oder Impulsen aus den Industrien zu schreiben, dem Hobby zu frönen. Das ist nicht besser oder schlechter als professioneller Musikjournalismus zwischen Studio, Musizierenden, Label, Marketing, Werbung, PR, Journalismus selbst, Bühnen, Performances, Rezipierenden, Konsumierenden und eben Fans (und Wissenschaffenden sowie weiteren Beobachtenden). Aber, und das ist der Grund für die ganze Vorrede, die zu dieser Freiheit gehört, the message is also the medium, medientechnologische Freiheiten, die freilich (sic!) auch wieder mit neuen Rahmungen versehen sind, ermöglichen andere Rhythmen, andere Reichweiten. Und mir wird ermöglicht, zum einen den angehäuften Stapel weitgehend toller Platten abzurepräsentieren, die dementsprechend alle nicht gerade eben erschienen sind, die teilweise nicht einmal mehr die jüngsten Lebenszeichen ihrer Erschaffenden sind, die aber kamen, um zu bleiben. Dafür gibt es schon eine neu angelegte Sammlung, die dann hoffentlich so ca. im kommenden Herbst besprochen wird. Danke, Die Aufhebung, danke, liebe Promoter_innen, meine Kolumne läuft bekanntlich immer wieder an, aber gleich der Trost: Diese Alben sind hängen geblieben, das ist m.E. in den Mengen von Veröffentlichungen sehr viel wert. Und erklärt auch gleich, warum hier zu ganz großen Teilen so positiv besprochen wird. Nicht um Werbung zu intendieren, sondern weil einem schlichtweg die Energie für Verrisse fehlt. Der böseste Verriss in der Aufmerksamkeitsökonomie auch des Netzes ist die Nicht-Erwähnung.
»Wir sind sicher« – Now (inbetween before now and from now on)
Deswegen soll hier und jetzt die Erwähnung einer neuen Band getätigt werden, von der ich nichts wusste, keine Werbung erhielt und bisher auch ›nur‹ zweieinhalb Singles erschienen sind: Gewalt. Nein, nicht Die Nervens Max Riegers All Diese Gewalt, auch ein tolles Projekt, sondern Gewalt, die neue Band von ›Patrick Wagner Superstar‹, der uns insbesondere um die Jahrtausendwende mit seiner so wichtigen Niemals-Vier-Viertel-Takt-Krachband Surrogat und dem Label Kitty Yo. beglückte, dass neben seiner eigenen Band v.a. Acts wie Peaches, Gonzales oder Kante berühmt machte. Gewalt nun also knüpfen an Surrogat an mit Drum Machine und fetten Slogans wie »Das neue Gold heißt Pfand« oder eben »Wir sind sicher«, das würde ich mal mit dem für seine Ritualtheorien berühmten Ethnologen Victor Turner (2005: 135) vorantreibend erwidern: »Existieren heißt in Ekstase sein.« Gewalt sind fast noch ein Stückweit näher an Big Black, in jedem Fall bleibt Wagner, was mir Messers Sänger Hendrik Otremba zu seinem Konzerterlebnis von Gewalt schrieb: »Patrick Wagner Superstar, irre Mischung aus Steve Albini und Otto Waalkes!« Unbedingt bitte weiter auf diese Gewalt achten und selbst mal recherchieren!
Die neue Folge (für nur an der Musik und ihren Kontexten Interessierte – from now on)
Talking about Post Punk-Superstars: Ja. Alle Popwelt weiß, dass sich → Nick Cave nach dem mehrfach gebrochenen, australisch-schwarzhumoresken filmischen Meisterwerk 20.000 Days von 2014, bei dem alles augenzwinkernd erfunden schien und doch wohl zu großen Teilen im Kern an die Biographie des Sängers gekoppelt war, aufgrund des tragischen, viel zu frühen Unfalltods eines seiner Söhne in seine, nun ja, Höhle zurück zog. Das neue Album Skeleton Tree und der nunmehr auch auf DVD erschienene Film One More Time with Feeling sind die künstlerischen Zeugen dieser Einsicht. Der Film noch mehr als das sehr dunkle, reduzierte Album hinterlässt einen etwas ratlos. Wobei ich gelernt habe, dass genau das eine Herausforderung ist. Die Songs verarbeiten Caves letzte Jahre und vereinen sich zum wohl trostlosesten Album des Australiers seit Your Funeral, My Trial (1986) und The Boatman’s Call (1997). Genau das spendet dann doch wieder Trost, höre das verstörende und gleichzeitig umarmende Distant Sky. So funktioniert die Figur Cave mit ihrer Musik eben auch immer wieder. Es kann eigenes Leid in die Songs hinein gelesen und sich selbst entlastet werden (vgl. wissenschaftlich zu Cave die Beiträge in Welberry/Dalziell 2009 sowie Surall 2016 und Jacke 2013). Das gelingt freilich bei der Dokumentation des Entstehungsprozesses und der sehr persönlichen Kontexte nicht. Zu stark wiegt das Schicksal. Bleibt irgendwie zu hoffen, dass Cave und seine Familie One More Time with Feeling als therapeutische Maßnahme auswerten können. Ich habe mir geschworen, diesen Film nicht mehr sehen zu wollen, weil mir Cave auf seine Art viel zu nahe kam und ich zuvor immer eine angenehme Distanz zum Menschen Cave empfand. Und dann, nach Monaten, wachsen insbesondere dieses entrückte und doch konzentrierte Album (rund um den Song Magneto, der dem Film seinen Titel gab) und auch die Umkehrung von 20.000 Days namens One More Time with Feeling immer weiter und wird Cave als Figur und Typ immer unklarer. Das ist beunruhigend und beruhigend zugleich. All das wird auf Skeleton Tree reduziert und, ja, skeletös inszeniert. Während das auch neu erschienene Best-of-Album Lovely Creatures eine über drei CDs/LPs kompilierte Werkschau darstellt, die vor der jüngsten biographischen und musikalischen Wende im Jahr 2014 endet und sich doch auch nicht von deren Assoziationen frei sprechen kann. „Nick Cave is a Bad Seed.“, schreibt der Weggefährte, Schriftsteller und Drehbuchautor Kirk Lake in seinem lesenswerten Essay über Cave im opulenten, reichlich bebilderten Booklet der Lovely Creatures. Wobei es der Metaphern manchmal etwas viele sind, wenn Cave etwa als Kapitän des guten Schiffs Bad Seed beschrieben wird. Nun denn. Wichtiger: Cave sei, so Lake, weiter auf der explorativen Jagd nach diesen liebenswerten Kreaturen. Je nach Edition gesellen sich zu den CDs dann eine DVD mit Interviews und Clips und mal eben ein dünneres Booklet, eher als Büchlein zu bezeichnen, oder mal ein sehr aufwendig gestaltetes, lohnenswertes Hardcover-Buch mit über 250 Seiten, längeren Essays u.a. zu einzelnen Songs oder Alben, zur Musik, Theologie (vgl. auch Surall 2016), zur australischen Sprache, zum Klang des Kinos oder zur Kraft der Orte bei Nick Cave And The Bad Seeds – und einem (vorläufigen) Schlusswort von Cave selbst: „The Bad Seeds made ‚Skeleton Tree’ in Paris towards the end of 2015 – in a strange, raw and different present. Whatever ‚Skeleton Tree’ became, it was a wholly necessary addition to the band’s story.“ In der Songauswahl bleibt es für hart gesottene Fans wenig überraschend, für ‚Neu- und Mittelneueinsteiger_innen’ wird hier eine gute Überschau über die Balladen, Schmonzetten, Krach- und Swamp Blues-Songs des eigenwilligen Australiers und Wahl-Berliners, -Brasilianers und (mehrfach)-Briten gegeben.
Während Cave und seine vielfältigen und vor allem vielseitigen Projekte immer da waren, verschwanden die → Pixies und deren Mitglieder zwischendurch fast gänzlich von der persönlichen Bildfläche. Dabei waren sie für viele das logische Bindeglied zwischen Post Punk, Grunge, College Rock und Indie Pop. Im Grunde waren sie neben und nach den immer etwas ernsteren Sonic Youth und deren ‚Wall of Sound’ und den brachial-düsteren, komplett irren Big Black (vgl. Jacke 2016) immer die bunte, knallige (Pop!) Quietschversion, dabei gleichwohl niemals niedlich oder bonbon-artig. Giftig und rau waren die zuckersüßen Songs von Deal, Francis, Santiago und Co., ihre beiden ersten Alben bleiben dafür wegweisend. Nach dem starken Comeback mit drei EPs und dem Album Indie Cindy in den Jahren 2013 und 2014 wird bereits recht schnell wieder nachgelegt (vgl. auch Stillbauer 2016). Anders als Cave fällt es ein wenig schwer, bei den Pixies, trotz neuer Bassistin, wirkliche Entwicklungen, Suchbewegungen oder Irritationen zu finden. Deswegen muss man den Bostonern nicht böse sein. Mich hat allerdings Indie Cindy mehr erfreut als die völlig okaye Fortsetzung.
Bleiben wir noch ein bisschen bei alten Heldinnen und Helden, dieses Mal allerdings ohne neue, sondern gleich mit den alten Songs. So wie Pop immer erfahrener wird und sich dennoch weiterhin neu erfindet kann anerkannt werden, dass der Fundus an Material nicht nur durch Digitalisierungen und damit zusammenhängende Speicherplätze unendlich groß zu werden scheint, verlangt es irgendwie immer mehr nach Orientierung. Manche Filterung übernehmen dann immer noch Plattenfirmen, Künstlerinnen selbst oder Journalisten, immer aber auch begleitet von Marktmechanismen, also etwa der Chance auf Verkauf. Immer mehr Rückblicke, Re-Issues, Limited Deluxe Editions und Compilations erscheinen, wobei diese zumindest teilweise sehr sinnvoll in mehrfacher Hinsicht erscheinen. → Still in A Dream: A Story of Shoegaze 1988-1995 beispielsweise ist ein als Buch aufgemachtes schillerndes Package: Fünf hübsch verpackte CDs und ein kleines Buch mit Texten zu den insgesamt 87 (!) Songs lassen vor allem akustisch und auch visuell wieder- oder nachempfinden, wieso dieses erst später so genannte Genre des Shoegazing, also introvertierte und auf den Bühnenboden, ihre Schuhe und die Pedals blickende Musiker_innen, so wichtig für Brit Pop und Psychedelic Rock war. Wer dieses Stück nicht nur (siehe die hier auch vertretenen Flaming Lips, Mercury Rev, Galaxie 500 oder Luna), aber doch vorrangig britischer Indie-Geschichte nicht sowieso schon im Schrank stehen hat, erst Recht, wer vielleicht viele dieser Acts noch gar nicht gehört hat, sollte diesen großen, fein kuratierten ‚Überhör’ von The Jesus & Mary Chain, Cocteau Twins über Spacemen 3 (und deren Nachfolger Sonic Boom, Spectrum und Spiritualized), Slowdive und Darkside bis zu Seefeel, Drugstore und Flying Saucer Attack unbedingt erkunden. Abgesehen von dem Aspekt, dass sich u.a. bei einigen dieser Damen und Herren aktuell neue Alben, Konzerte, Performances oder zumindest Gerüchte um Revivals ergeben, strahlen die alten Songs eine derartige Schönheit und Kraft aus, dass Still in A Dream definitiv traumhaft ist.
Die oftmals unverständlicherweise so gescholtenen Achtziger werden gleich mit vier weiteren Boxen vollkommen zu Recht geehrt: → C87 schließt mit drei CDs an den legendären (und auch bereits wieder erschienenen und ausgeweiteten) → C86 an und präsentiert damaligen mal krachigen, schrägen (Talulah Gosh, Bogshed), mal fast ravigen (The Shamen, Inspiral Carpets), mal einfach nur gitarrig schönen (The House of Love, Biff Bang Pow!, The Primitives) Prä-Brit Pop. Auch → C88 setzt mit ebenfalls drei CDs dort an, im Land zwischen Sixties und Eighties spinnen teilweise etwas in Vergessenheit geratene Bands wie The Raw Herbs, The Revolving Paint Dream oder East Village sowie bekanntere Acts wie Hangman’s Beautiful Daughter, The Darling Buds, The Stones Roses oder Pale Saints an, klingen oftmals wie eine Mischung aus den Byrds und Beatles gekreuzt mit den frühen Acts des legendären Creation-Labels (siehe Teil 4 meiner hiesigen Kolumne) und einigen frühen British Rave-Anflügen (The Shamen, Inspiral Carpets). → Another Splash of Colour. New Psychedelia in Britain 1980-1985 widmet sich ebenso aufwendig und vielseitig dem eher psychdelischen Brit Rock, der auf den bereits genannten Zusammenstellungen auch vertreten ist: Robyn Hitchcock, The Monochrome Set, TV Personalities, Julian Cope, The Barracudas oder die unvergesslich (!) tollen Cleaners from Venus. → Close to The Noise Floor. Formative UK Electronica 1975-1984. Excursions in Proto-Synth-Pop, DIY Techno and Ambient Exploration taucht eher tief in die Industrial-, New Wave- und Geräusch-Musik-Bereiche ein und bringt viele unbekannte Größen ans Tageslicht ebenso wie die Compilation zeigt, woher ursprünglich spätere Megaseller-Acts wie Blancmange, Orchestral Manouvers in The Dark oder The Human League gekommen sind und was aus Throbbing Gristle (hier mit Chris & Cosey), Ultravox (hier mit dem phantastischen, bis heute aktiven Ex-Sänger und Songwriter John Foxx) oder Wire (Hier mit bcGilbert, gLewis, russell Mills) geworden war. Noch einen Schritt weiter in düstere, pathetische und dennoch innovative Gefilde, manchmal auf der Grenze zum Überzogenen oder dann doch Peinlich-Theatralischen (Fields of The Nephilim) geht die Fünfach-CD-Box → Silhouettes & Statues. A Gothic Revolution 1978-1986. Lässt man sich genauer auf diese Songs ein, fällt auch auf, wieso neben durchaus wirkungsvollen und erfolgreichen Karikaturen wie den bereits Genannten oder Alien Sex Fiend hier so viele wichtige Post Punk-Bands im Grunde einen dunklen Rock’n’Roll spielen. Bauhaus etwa haben nie einen Hehl aus ihrer Verehrung für David Bowie gemacht, The Sisters of Mercy (in der Band-Phase, also vor Eldritchs Solo-Manie und Steinman-Bombast-Produktion) und Red Lorry Yellow Lorry liebten Iggy & The Stooges, The Birthday Party (featuring Nick Cave und Rowland S. Howard) wollten Macho-Rock à la AC/DC zerstören. The Rose of Avalanche orientierten sich anfangs stark an Lou Reeds The Velvet Underground, später an The Doors. Und so wird Pop-Geschichte in Geschichten weiter geschrieben. Besonders erkenntnisreich sind die zahlreichen Verquickungen und Überschneidungen vieler Bands oder ihrer Miitglieder auf und zwischen den genannten Compilations. Das kann auf wenig trennscharfe Kategorien, vielfältige Aktivitäten der Bands oder auch zusammenhängende Szenen hindeuten. Eine Band wie die des durchgeknallten Chefs von Creation-Records, Alan McGee, Biff Bang Pow! , war eben sowohl im Gitarrenpop à la Smiths als auch in psychedelischeren Bereichen zu finden, der niederländische Act The Legendary Pink Dots empfand sich eher als ebenfalls dort ansässig, wurde aber auch immer wieder in Gothic und Dark Wave-Kreisen goutiert. Auch hier wäre archivierend, musealisierend oder zumindest erst einmal journalistisch und popmusikkulturwissenschaftlich noch einiges an Aufarbeitung zu leisten.
Dieses Weiterschreiben wird gleichermaßen von Zeitzeuginnen wie auch zwingend von Neueinsteigenden praktiziert, weswegen die Rereleases und Zusammenstellungen durchaus eine Wertigkeit über den Markt hinaus haben. Eines der wichtigsten New Wave-Alben bleibt das seinerzeit 1979 erschienene Half-Mute der im Grunde globalisierten Band → Tuxedomoon mit US-amerikanischem Kern. Beeinflusst von Kraftwerk und frühem Synthie-Pop genauso wie vom Punk und von diversen Kunstrichtungen waren Songs wie 59 to 1 oder What Use? dystopische Soundtracks, die mittlerweile in ihrer Ästhetik und Haltung schon wieder an Aktualität gewonnen haben. Bei diesem Rerelease gibt es als Bonus ein zweites Album (Give Me New Noise. Half-Mute Reflected) mit spannenden Bearbeitungen der Originale durch u.a. Simon Fisher-Turner, Palo Alto, Foetus oder Cult with No Name. Eben jene Cult with No Name haben sich gemeinsam mit Tuxedomoon und einigen Gästen, wie etwa John Foxx auf dem tollen, an Brian Eno erinnernden Stück Lincoln Street, beinahe neoklassisch an die Vertonung der Dokumentation von Peter Braatz (aka Harry Rag von S.Y.P.H.) über den Film-Klassiker Blue Velvet begeben. David Lynch hatte den damals jungen deutschen Filmemacher eingeladen, sehr nah am Set, an den Schauspielern und an ihm selbst zu filmen. Hier ist durch die verschiedenen Reibungen aus neu und alt, Film und Musik, Spiel und Doku, Post Punk/New Wave und Klassik/Jazz, Theater und Pop eine sehr aufregende Kooperation entstanden.
Ebenso faszinierend ist die Weiterführung des erst neulich ausgegrabenen, aus einem ähnlichen Umfeld stammenden Projekts von → Véronique Vincent und Aksak Maboul, deren Ex-Futur-Album letztlich erst 2014 veröffentlicht wurde (siehe Teil 3 meiner hiesigen Kolumne) und nun als 16 Visions of Ex-Futur in neuen Versionen gemeinsam mit Neubearbeitenden wie u.a. Burnt Friedman, Laetitia Sadier, Capitol K oder Nite Jewel aufbereitet wurde.
Und auch wenn die Mühlheimer Helge Schneider-Weggefährten → Bohren und Der Club of Gore selbst die Assoziationen zu David Lynchs Filmen und Soundtracks nicht so sehr schätzen (vgl. Dax 2017), sei hier für Neueinsteiger anhand der Compilation Bohren for Beginners am Ende dieses Blocks absolut empfohlen, deren Zeitlupen-Doom-Jazz-Slowest-Core zu entdecken, wenn Bohren selbst eben auch Jazz nicht so richtig erkennen können (vgl. ebd.). Entdecken Sie selbst!
Und jetzt mal richtig ‚Neues’ – from now on now on… (mal mehr, mal weniger)
Naja, wie auch immer man ‚neu’ definiert, soll es jetzt um gänzlich neue Songs gehen, also keine Wiederveröffentlichungen, Best Ofs oder Bearbeitungen im engen Sinne, einerlei, ob das neue, junge Acts wie Josefin Öhrn, Exploded View oder die Nots oder erfahrenere Musikerinnen und Musiker wie Masha Qrella, Wrangler (Stephen Mallinder von Cabaret Voltaire) oder gar Brian Eno sind. Jedenfalls haben wir oben ja schon mitbekommen, dass Pop in jeder Hinsicht historisch wird, gleichzeitig arbeitet sich Pop an sich selbst ab, die eigenen Geschichten immer wieder auf, referenzlos kann es hier prinzipiell gar nicht zugehen. Das soll und kann auch diese Kolumne letztlich nur leisten, anstelle einer detaillierten popmusikanalytischen Auseinandersetzung: „Was kann man also noch tun, was nicht schon, durch andere, wenn auch anders, aber eben doch: auch schon gemacht worden ist? Wie kann man – im Zeitalter angeblicher Rundum-Verfügbarkeit von allem Existierenden, ja: allem jemals Geschaffenen – frei arbeiten im Gefühl und unter dem Verdacht, heftig gegen die Zeit angehen zu müssen, weil ja gerade jetzt jemand genau das macht, was man selber erst entdeckt und machen möchte?“ (Reck 2016: 34)
→ Julianna Barwick aus Brooklyn scheidet die Geister, das ist zunächst eine gute Start-Option. Für die einen Beobachter ist sie eine Künstlerin, die um ihr Piano und ihre ätherische Stimme herum Klanglandschaften aufbaut, Flächen komponiert und vor allem mit Loops diverser Art experimentiert, dennoch aber am Pop orientiert bleibt. Für andere Kritiker wirkt sie zu, nun denn, elfenhaft und aufgesetzt pathetisch. Mal wieder scheint es auf den Betrachter anzukommen. Will jedenfalls, das dritte Album der auch für Yoko Ono musizierenden Pianistin, zieht einen, wie auch ihre Performances, gehört man zu ersterer Gruppe von Beobachtern, vollkommen in Barwicks ambiente Wolken (Nebula), saugt einen förmlich auf und – schaut man noch mal zurück auf Caves wahrlich anders gelagerte und von seinen Lyrics lebende Musik – spendet Trost: Heading Home eben. Ja, fast religiös im Sinne von transzendental (vgl. zu Pop, Transzendenz und Religion Aha 2017, Flath/Jacke 2017). Ähnlich erging es mir immer mit Beth Gibbons und Portishead, wobei diese insbesondere zuletzt wahrlich nicht sphärisch wie Barwick klangen, sondern ruppig, drogig, krautig. Dennoch lässt Gibbons (insbesondere auf ihrem etwas überhörten Soloalbum) einen wegrücken. → Joe Volk aus Bristol hatte schon vielfältige Berührungen mit dem Portishead-Zirkus. Adrian Utley hat Volks Album Happenings & Killings mit produziert. Dessen ehemalige Band Crippled Black Phoenix, die er 2013 verließ, veröffentlichte auf Geoff Barrows Label Invada. Der wiederum gemeinsam mit dem Komponisten Ben Salisbury den verstörenden Soundtrack zum Science Fiction-Film Ex Machina schrieb und die als Team auch hier mitgewirkt haben. Volk ist also bestens eingebettet. Und das hört man. Idealerweise lässt man sich passend von Barwicks letztem Song See, Know überleiten zum leisen, ernsten Beginn von Volks neun Songs: Bampfyde Moore Carew. Anschlüsse zu folkigen Elementen bei Portishead (oder eben Gibbons solo) oder auch zu den großen verstorbenen Nick Drake und Jeff Buckley klingen an. So steigert sich diese Musik auf Inselplattenniveau: Hört doch mal Soliloquy, ein balladesker und doch auch eckiger Song, der nicht nur Samstage, sondern Leben retten kann. Und so geht das unmunter weiter. The Walker. Puh. Was für ein tolles Album, das an dieser Stelle zurück zu den Eingangszitaten führt.
Und dann doch auch wieder weiter. Bis zu den → Explosions In The Sky, die in der hiesigen Kolumne bereits mehrfach Thema waren (siehe Teil 1 und 4 für deren Seitenprojekt Inventions) und (nicht nur) deren Mini-Hit The Ecstatic beinahe an instrumentale The Cure aus deren mittlerer Phase erinnert, die auch jüngst noch mal mit Plainsong im Abspann des grandiosen Toni Erdmann-Films geehrt wurden. Wobei es schon mit dem marschierenden Logic of A Dream und Disintegration Anxiety oder dem wunderschönen Landing Cliffs wieder in eher postrockig-orchestrale Richtung geht. Sie bleiben neben Mogwai und Mono eine der beeindruckendsten Instrumentalbands dieses Bereichs. Wie Julianna Barwick kommt auch Robert Toher von Eraaas aus Brooklyn, bei ihm hört man die HipHop-Beats deutlicher als im ambienten Pianosound von Barwick. Sein Soloprojekt → Public Memory erinnert in guten Momenten (Cul De Sac) an gute Zeiten von The Album Leaf und einem einst im Dunstkreis von The Notwist, Lali Puna, Mice Parade und eben genannten gehypten Genre namens Indietronics. Public Memory nehmen freilich noch eine Schippe dunklem Synthie Pops à la Gary Numan dazu, werden in Stücken wie Mirror beinahe etwas arg sakral, bitte nicht noch einen Schritt weiter in Richtung Mittelaltermarkt! Je hoppiger und dubbiger Toher wird, höre Ringleader, desto besser gefällt mir diese eigene Art von Indietum.
Auf ähnlichen Schnittstellen unterwegs ist seit einigen Jahren und mehreren ganz tollen Alben (das neue ist sage und schreibe ihr zehntes) die in Tiflis/Georgien geborene Musikerin → Natalie Beridze. Neben Gedichtvertonungen, Filmmusiken und Kollaborationen mit u.a. Ryuichi Sakamoto, Antye Greie und Thomas Brinkmann hat sie für mich nunmehr ihr absolut bestes Album vorgelegt. Was heißt das? Ich würde sagen, dass, wo vorher Andeutungen waren, nunmehr Konsequenz und Deutlichkeit angesagt ist. Dass wo manch ein Mini-Hit verhuscht um die Ecke verschwand, jetzt endlich dazu gestanden wird, eben schlichtweg große Songs zu schreiben. Gleichwohl ist Guliagava nicht pompös oder angeberisch. Beridze hat die Schönheit mit leichter Spookyness verbunden und lässt dieses seltsame Gefühl nun über ein ganzes Album durchlaufen, exemplarisch sei gleich mal auf das erste luzide Stück For Love verwiesen. Neben der wunderbaren Lucrecia Dalt die tollsten Sounds und Songs der letzten Jahre eines Ein-Frau-Projekts zwischen Electronica, Ambient und eben Indietronics. Und immer wieder von vorne, dann entdeckt man plötzlich Jazz, John Cale, Aphex Twin, Boards of Canada, Bersarin Quartett, ein Talk Talk-Sample auf „Those Things“ und all den geilen Scheiß, das geht bis ins Mark. Eine große kleine Sensation! Wo Frau Beridze letztlich dann doch warm singt, marschiert Anika Henderson eiskalt und doch schlingernd. Als Anika nahm sie bereits die Kühle von Velvet Underground trifft Portishead trifft Kim Gordon oder Thalia Zedek auf. Mit → Exploded View hat sie jetzt auch eine Band, die das Ganze etwas opulenter inszeniert. Eine kleine Supergroup mit Martin Thulin, dem Produzenten der Crocodiles, Hugo Quezada von Robota und Hector Melgarejo von Jessy Bulbo und Nos Ilamamos hievt Henderson auf ein tatsächlich noch intensiveres Niveau, Orlando etwa ist wie für den kalten Tanzboden gemacht. Selten so schön hoffnungslos und cool postpunkig verhallt herumgeeiert. Was für ein aufbauendes Elend! In diesen Reigen passt dann auch eine weitere wichtige Frau des irgendwie unweigerlich mit Berlin zusammenhängenden Sounds der letzten Jahre: → Masha Qrella, die sich von einstig instrumentalem Postrocky bei Contriva und über feine erste Solosongs wie u.a. phantastische Coverversionen von großen Hits der Chills (Pink Frost) oder von Bryan Ferry (Dont’t Stop The Dance) bis hin zu Weill-Vertonungen und viel mehr eigenen englischsprachigen Stücken landet Qrella auf den elf Songs von Keys bei sich selbst. Disco und Melancholie hat die Songschreiberin bisher auch schon, aber noch nicht so stringent verbunden, eben ein Ticket to My Heart, also ‚her’ Herz bzw. das der Persona, die den Song vorträgt. Ach komm, weg jetzt mal mit den Schlaufen, Ebenen und Distanzierungen, Masha Qrella hat berührende Songs produziert, die einen anschauen und sich nicht mehr verschämt und vermeintlich cool hinter dem Pony und Wegblicken mit runter gezogenen Mundwinkeln verstecken. Pale Days wollen mit einem tanzen. Und wie souverän und doch nie berechnend. Fallen lassen. Jetzt.
Nochmal einen Schritt zurück aus Liederschreiberland zu den Indietronics: Qrellas Labelmates → Isan waren da stets sehr weit vorn: Zurückhaltende Beats treffen auf flächige Soundscapes und langsam ins Hörbild driftenden Melodien, die dann ebenso vorsichtig wieder ausgeblendet werden. Nach sechs Jahren Pause und insgesamt auch schon wieder zwanzig Jahren Dabeisein haben Antony Ryan und Robin Saville ihr achtes Studioalbum veröffentlicht. Glass Bird Movement schließt an all die Verweise bei Natalie Beridze an, passt sich förmlich an die Stimmungen aller vorangegangener Alben an. Isan aus Leicester und teilweise Schweden könnten eigentlich auch aus Neuseeland kommen, keinesfalls stereotypisch oder klischeehaft, sondern voll ernsthafter Links, ob das nun Tiere oder Landschaften sind. Hier also die anfangs erwähnte Freiheit der Verbindung, weniger Songs von damals als vielmehr Songs zum Damals. Vielleicht liegt das auch wieder im und am Ohr des Betrachters und dessen Dahinter liegender Erinnerungen. Mag sein. Dennoch würde eine empirische Überprüfung, so denke ich, diese Assoziationen bei kiwipoperfahrenen Hörenden bestätigen, hier eben weniger in einer Dream oder Indie Pop, sondern Electronica-Variante.
Diesen Sound von Isan nehmen die aus der Schweiz stammenden → Wolfman zwar ansatzweise auf, drehen das Ganze aber durch den reflektierten Electroblues-Fleischwolf (haha) und landen bei ganz anderen Gedächtnisleistungen. Katerina Stoykova und Angelo Repetto könnten nämlich mit einzelnen Songs auch auf einigen der oben genannten Compilations vertreten sein, nur klingen sie kultürlich mehr nach 2017 und sind sie letztlich doch näher an einer clubbigen Variante von dunklem Synthie Pop als am New Wave oder New New Wave. Gleichzeitig bewegt sich Modern Age eben auch an bluesigen und souligen Songs verrauchter Abende entlang, letztlich näher an Morcheeba und TripHop als an den Indietronics.
Von einer gänzlich anderen Seite an den Dancefloor gehen Stephen Mallinders, Phil Winters und Benges → Wrangler: Hier häufen sich Geschichten von Cabaret Voltaire aus Sheffield, deren Sänger Mallinder lange Jahre war, bevor er in die Popmusikforschung einstieg und den funky Post Industrial von CV seinem Weggefährten Richard H. Kirk überlies. Dabei setzen genau dort auch Wrangler an, die durch Winters Erfahrungen mit Tunng und Benges Neuentdeckung des frühen, ersten Ultravox-Sängers und Eletronikpop-Pioniers John Foxx gar nicht so weit entfernt scheinen. Futuroretroistisch wird hier eben bei New Wave und Industrial Funk angesetzt, ergänzt oder besser verziert von Mallinders unnachahmlicher hohl-metallischer Stimme wie sie speziell auf einigen Alben Cabaret Voltaires der mittleren bis späten Achtziger (v.a. das seinerzeit fulminante, ja geradezu verstörende Micro-Phonies von 1984 und das dancigere Code von 1987) auch zu hören war: Mal zackig (superfunkysexy Dirty), mal herrlich verschleppt (die Single Stupid) wird hier der analogen Synthesizer und Referenzen auf Kraftwerk, John Foxx und immer wieder Cabaret Voltaire selbst gefrönt. Unbedingt wieder oder neu zu entdecken durch den sehr aktuellen und tollen Filter von Wrangler. Wo wir schon bei Elektronik-Legenden oder -Ikonen wie Kraftwerk, CV, Foxx oder Mallinder sind: → Brian Eno bleibt sehr aktiv und produktiv: Mit The Ship und Reflection hat der ehemalige Roxy Music-Mastermind gleich zwei neue Alben vorgelegt. Ambient als Genre wurde seinerzeit von Eno mitgeschaffen und geprägt. Auf beiden Alben widmet er sich langen und sehr langen Tracks (auf Reflection einem einzigen, gleichnamigen 54-minütigen Stück), die nicht mehr so durchaus angenehm variabel und fast zappelig wie auf dem 2010er-Werk Small Craft on a Milk Sea klingen, gleichwohl auch nicht an einem vorbeifließen. Brian Eno hat uns schon so viele tolle Alben, Kooperationen, Produktionen (u.a. die für mich besten Bowie-Alben neben dessen letzten beiden, aber auch Fürchterlichkeiten wie U2) und Extras wie die Oblique Strategies-Karten für kreatives Arbeiten geschenkt, was soll da noch kommen? Nun, The Ship (mit Gesang!) und Reflection, die unterschiedlich konzipiert sind, mal angedockt an ambiente Vorläufer, mal an Kunstausstellungen bzw. Klanginstallationen von Eno selbst, ruhen in sich selbst, Reflection noch mehr, etwas dunkler als The Ship. Hier kann ein- und ausgestiegen werden, hier kann sich konzentriert oder zerstreut werden.
Zwei Schritte zurück und einen vor, nur kurz und dann immer weiter, weiter…
Apropos alte Helden nochmal: Obwohl mir → Blixa Bargelds Rolle für die (deutschsprachige) Geräuschmusik (vgl. Kniola 2017) als Kopf der Einstürzenden Neubauten (siehe Teil 3 meiner hiesigen Kolumne), als wichtiges Mitglied von Nick Caves Bad Seeds (siehe oben, wenn Bargeld auch nicht mehr involviert ist) oder als Kooperierender (u.a. etwa mit Alva Noto oder eben dem italienischen Komponisten und Labelmacher → Teho Teardo) vollkommen klar ist, stört mich bis heute der etwas schnöselig-künstlerische Gestus. Seine Vorliebe für das schwärzeste Schwarz (Nerissimo), mal englisch-, mal italienisch-, mal deutschsprachige Texte und die eher dunkel-ruhige Seite seiner Musik stellt Bargeld auf dem zweiten Album mit seinem kongenialen Klanggestalter und Filmmusiker Teardo aus. Wenn er zum reflektierten und merkwürdigen Geschichtenerzähler wird und Teardo ihn in (kammer-)orchestrale Rahmungen voller Streicher, Bläser, Glocken etc. setzt, dann lässt Bargeld eine/n in seine Welten hinein fallen – oftmals gar nicht weit von den sanfteren Phasen der Neubauten entfernt. In diese Songs hinein könnte Stalker’s Sentiment gemischt werden, der in seiner trocken-dunkelgrauen Stimmung sehr passende erste Track von → Ritornells ebenfalls sehr kammerorchestralen Albums If Nine Was Eight. Das dritte Studioalbum der Österreicher Richard Eigner und Roman Gerold erkundet Möglichkeiten jenseits mathematischer Parameter und wirkt dennoch im positiven Sinne sehr komponiert. Unterstützt von zahlreichen Freunden aus dem Umfeld der Wiener Symphoniker und um die Vocals von Mira Lu Kovacs (auf Odd People) und Tobias Koett (auf Sleeping Alone) driften Ritornell immer wieder in jazzig-soulige Gefilde, lassen die Hintertür zu doppelbödigeren und technoideren Musiken dabei aber stets geöffnet, wenn auch faszinierend ernsthaft.
Diesen Ansätzen nahe kommt seit geraumer Zeit auch der Norweger → Stian Westerhus mit seinen diversen Ensembles und Projekten (siehe Teil 2 meiner hiesigen Kolumne). Erfreulich unleichte Kost sind auch dessen Tracksongstücke. Und machen pure Interpretation schwierig und Spurenlesen erforderlich: „Im Antlitz zeigt sich etwas, das nicht als Anzeichen verstehbar gemacht werden kann. Es ist ein Zeigen, das kein Verweisen mehr ist. Ein solches Zeigen aber ist dasjenige der ‚authentischen Spur’.“ (Krämer 2008: 288) Und weiter: „A posteriori können wir beim ‚gelingenden’ Spurenlesen dann sagen: Die Materialität der wahrnehmbaren Spur repräsentiert ihre nicht mehr wahrnehmbare, mithin abwesende Ursache.“ (Krämer 2008: 295) Reduziert man Amputation um die technische Idee als 16.1-Surround-Intsallation (das kann hier und bei den meisten von uns wohl leider eher nicht geleistet werden) bleiben diese Stücke außerordentlich sperrig und doch mitreißend. Der mehrfach graduierte studierte Gitarrist Westerhus rollt uns mit diesen sechs langen Stücken verquere und doch für seine Verhältnisse fast schon poppige Dinger vor die Tür. Klar winken von ganz weit draußen und hinten Scott Walker, James Blake und Ben Frost, da ist der Waschzettel zum Album nachvollziehbar (allesamt klingen in Kings Never Sleep an), wobei sich fragt, ob wir mit Westerhus nicht im Moment der Rezeption ganz weit draußen, irgendwo anders sind? Und macht das nicht gute Popmusik aus? Uns komplett woanders hin zu beamen? Ist das Transzendenz? Muss ich darüber jetzt nachdenken? How Long? Was für ein Stück… Nö, muss ich nicht, ich möchte lieber noch tiefer einsteigen in Westerhus’ verstörende Sounds und Konzepte.
Wo Westerhus eher an Avantgarde, Experiment und Geräuschmusik arbeitet, trifft auf den umtriebigen Niederländer → Joep Breving das Konzept der oft benutzten Neoklassik zu, hier in deren reduzierter Form, kein Wunder also, dass dieser neben seinem sehr melancholisch-stylishen Album Solipsism, das erst seinen Weg auf die Märkte finden musste, ursprünglich bereits 2015 selbst veröffentlicht worden war, auch gleich noch mit Prehension eine Produktion für die seit geraumer Zeit auf Popsuche befindliche Deutsche Grammophon herausgebracht hat. Im Grunde erschienen also gleich zwei Alben kurz hintereinander zu sehr unterschiedlichen Phasen des studierten Pianisten. Die sehr getragenen Pianostücke von Breving leben von ihrer Ruhe, Konzentration und Reduktion. Nicht so leicht wie Chilly Gonzales, an dessen Pianoalben Brevings Etude erinnert, nicht so ausgeschmückt wie Ólafur Arnalds, nicht so besungen wie Peter Broderick und nicht so bewusst leicht kitschig wie Bersarin Quartett hat Breving, der im Prinzip immer gerne in einem Take aufgenommen hat, seinen Weg gefunden. Das lässt sich locker hintereinander hören, ohne dudelig zu werden, Prehension ist dabei mit Stücken wie Seelenkind oder Sonderling fast noch etwas gediegener als das demgegenüber fast noch naive Solipsism. Chopin und Satie lassen jedenfalls neoklassisch herzlich grüßen. Ähnlich schön und doch auf eine gänzlich andere Art fast andächtig sind die Soundflächen und -wellen des Software-Engineers und Multiinstrumentalisten → Christopher Tignor. Im Gegensatz zu seinen technologischen Kompetenzen (Tignor schreibt die benutzte Musiksoftware gleich selbst und spielt zudem u.a. Violine, Schlagzeug und Viehglocke) stehen seine von ihm selbst als Meditationen zu Geduld und seelischer Kraft beschriebenen Songs. Damit reiht sich der US-amerikanische Komponist ein in die Gruppe von Musikerinnen und Musikern, die der vom Soziologen Zygmunt Bauman als Adiaphorisierung beschriebenen Gefühlslosigkeit etwas entgegensetzen wollen: „Der wichtigste Effekt des Fortschritts in der Distanzierungs- und Automatisierungstechnologie ist die zunehmende und vielleicht unaufhaltsame Befreiung unseres Handelns von moralischen Skrupeln. [Hervorh. i. O., C.J.]“ (Bauman zit. n. Bauman/Lyon 2013: 110) Tignor benutzt die Stimmgabel als Instrument und erschafft instrumentale, an Filmmusik erinnernde Songs, die etwa auf One Eye Blue, One Eye Black an mittlerweile etwas verschüttete Acts der Neunziger zwischen Klassik und Postrocky wie Rachel’s anknüpfen.
Noch weniger rhythmusbetont und schon seit Ewigkeiten in meiner Ablage unbedingt noch zu rezensierender Alben befindlich und nun endlich zu würdigen sind die sphärischen Erkundungen am analogen Synthesizer des kanadischen Musikers, Klangkünstlers und Designers → Christopher Bissonnette. In seinen modularen Synthesen auf seinem zweiten Synthesizer-Entdeckungsalbum Pitch, Paper & Soul, so beschreibt Bissonnette es selbst, lässt er Field Recordings, Planung und Spontaneität einfließen. Irgendwo in der Nachbarschaft von Tim Hecker und Labradford, doch noch viel deutlicher als diese mit Referenzen der frühen Synthesizermusik der Siebziger arbeitend, tastet sich dieser akribische Forscher behutsam, doch auch immer wieder mit Distortion oder Zufallsprodukten rechnend, durch die Möglichkeiten der Geräte. Schillernd sind die Ergebnisse!
Und noch schillernder ist das folgende Album, wenn ich es könnte, würde ich hier blinkende Ausrufezeichen oder andere Hinweise innerhalb dieses Teils meiner Kolumne ausstellen: → MJ Guiders Precious Systems ist nicht weniger als die ‚Schönheit dieser Ausgabe’. Ausrufezeichen! Blinkt. Vernebelt allerdings. Wie die Sounds und halligen Gesänge von Melissa Guion und ihrem Trio aus New Orleans. This Mortal Coil, Cocteau Twins, Grouper, Lucrecia Dalt und ein wenig auch die hier schon oben besprochenen Anika und Julianna Barwick tauchen im Hintergrund der berauschenden Songtracks von MJ Guider auf. Das ist Indie, das ist Schuheglotzen, das ist vor allem wegdriftend tanzen, verhallt wie einst bei Basic Channel, aber eben besungen und poppiger. Selten wurde so fluffig marschiert und zwischendurch auf Evencycle ins Land von GAS’ Narkopop mäandriert. Das ist einfach nur toll (genauso übrigens wie Narkopop)! Nach dem Sturm von MJ Guider kann gut eine beinahe gespenstische Ruhe und Gelassenheit von Scott Morgan aka → Loscil aus Vancouver einkehren. Es verwundert nicht, dass beide Acts auf dem phantastischen Label Kranky ihre angekränkelten Ambientsounds veröffentlichen. Mensch, als ich gestern im Kino den Musikfilm Denk ich an Deutschland in der Nacht sah, fiel mir bei allem Respekt vor einem durchaus wichtigen Film zur elektronischen Musik und DJ-Culture auf, wie langweilig für mich die meiste Musik der dort vertretenen Acts war: Schon Loscil und MJ Guider beruhigen mich, in dem sie mich auf- und anregen. Loscil schwebt irgendwo herum, nähert (Red Tide) und entfernt (Drained Lake) sich laufend (oder umgekehrt), also bitte nicht zu sicher fühlen (wirklich nicht). Ein Track glänzt hier in Bescheidenheit mehr als der andere.
Vor 16 (!) Jahren schrieb ich anlässlich des damals neuen Albums Ovalcommers in der De:Bug über Dabei- und Dagegensein, Kunst und Musik sowie zirkuläre Prozesse überall. Das Interview mit Markus Popp in Köln begeisterte mich schier, dessen Programmierungen und Sounds begriff ich gleichwohl nur ansatzweise. Mit Popp hat → Oval meines Erachtens zwar ein neues Album produziert, gleichzeitig wirken diese Tracks zugänglich, fast zahm, nehmen einen eher an der Hand. Das ist schon ganz glasklar der Klang von Oval. Glitchy, viel clubbiger als damals. Früher war alles nicht schlechter als heute. Aber heute ist das schöner. Im Gespräch seinerzeit war es Popp wichtig, nicht einzuordnen zu sein. Da müssen wir den großen Experimentator nun leider etwas enttäuschen: Popp ist digitaler Oval-Pop mit grandiosen Beats bzw. grandios mit Beats. Popp spielt (herum), Popp steht deluxe für Mixophilie statt Mixphobie (vgl. Bauman 2016: 14-15). Oder anders gesagt: „Das Vervielfältigen von Material, welcher Provenienz und Form auch immer, hat sich im 20. Jahrhundert als explizites künstlerisches Arbeitsmodell etabliert. Im Unterscheid zu vordigitalen Tendenzen wie dem dadaistischen Readymade, dem Konstruktivismus, der Pop, Conceptual oder Appropriation Art – alles Strömungen, in denen die Grenzen von Original und Kopie erstmals aufgeweicht wurden – ist das Kopieren in digitalen Zusammenhängen für das aktuelle Kunstschaffen konstitutiv geworden und hat in inhaltlicher, formaler und materieller Hinsicht Auswirkungen darauf. Die verlustfrei mit digitalen Mitteln erzeugte Kopie ist sowohl übergeordnetes Denkmodell als auch konkrete Ausdrucksform, die sich auch abseits ihr ureigenster Zusammenhänge in künstlerische Produktions-, Rezeptions- und Distributionsvorgänge einschreibt und diese mitgestaltet. Dieser postdigitale Zustand – die Allgegenwart und gleichzeitige Unsichtbarkeit digitaler Technologien – forciert auch die Omnipräsenz der Kopie geradezu.“ (Thalmair 2016: 41) Oval leuchtet!
Geschichten zu Geschichte
Popmusikhistorisch hängen die → Silver Apples, eigentlich hauptsächlich Simeon Coxe aus Alabama, zwischen frühen Pink Floyd und späten Spacemen 3 bzw. Spectrum. Deren Mastermind Sonic Boom hat die Silver Apples auch in den Neunzigern mit wiederentdeckt und zu einem Comeback bewogen. Wobei gerade das neue Album, das erste seit übrigens 19 Jahren, sehr deutlich zeigt, warum auch Bands wie die Flaming Lips, MGMT oder Animal Collective sicherlich schon mal intensiver bei den Apples zugehört haben. Das ist zweifelsohne spacig, trippig, ja, psychedelisch. Ursprünglich waren Coxe und Band Ende der Sechziger aktiv, vor dem Release des dritten Albums wurde sich aufgelöst, sodass dieses gar nicht mehr das Licht der Welt erblickte, dann eben das Wiederaufleben inklusive Rereleases zu Beginn der Neunziger (u.a. mit Xian Hawkins aka Sybarite), und nun wirken die Silver Apples mit Clinging To A Dream als seien sie auf ihrer unendlichen Zeitreise über eine Schlaufe plötzlich wieder da. Trotz einiger Schicksalsschläge (Gründungsmitglied Danny Taylor verstarb nur 59-jährig): Oszillatoren, Synthesizer und Keyboards blubbern und klimpern zu verwaschenen Beats und Coxe singtspricht über bzw. durch diverse Effektgeräte seine Geschichten, die mittlerweile zu einem wichtigen Teil Psychdedelia-Geschichte geronnen sind. Stücke wie das rausgeschossene The Mist und das direkt anschließnede stampfende Susie sind absolut vorstellbar in dunklen Clubmusikmomenten und transzendieren hier Psychedelia zu Dub zu Indsutrial. Das ist schon ganz schön toll krude – und dann auch wieder eingängig und absolut clubbig, höre Concerto for Monkey and Oscillator. Da wird dann Geschichte wieder zu Geschichten. Ich bin begeistert!
Die Schwedin → Josefin Öhrn und ihre Band Liberation hat sich mit gleich zwei Alben in meinem Regal eingenistet, sowohl Horse Dance als auch Mirage atmen den Spirit der Silver Apples, wenn auch wesentlich rock’n’rolliger, wie Hörns Songs insbesondere auch live wirken. Wo aber die Silver Apples verspielter sind, scheint es Öhrn doch sehr ernst mit dem Ernst zu nehmen. Das gehört wahrscheinlich auch zum schwarz bekleideten Outfit. Wobei das hier nun wirklich keine Gruftis oder Gothics sind, sondern schwarze Jeans und Lederjacken gemeint sind – mit leichtem Düstereinschlag à la Wovenhand, höre Sister Green Eyes von Mirage, wobei der Song, vielleicht bewusst, leider etwas ins Born-to-Be-Wild-hafte abgleitet. Öhrn bewegt sich mit all dem für mich auch eher in einer ebenso gut konnotierten Psychedelia-Tradition nahe der Garage von Über-Schweden wie einst Union Carbide Productions, später The Soundtracks of Our Lives, mittlerweile Ebbot Lundberg solo. Da war der Horse Dance mit Mantras wie Dunes noch ein Stückweit überraschender als dann Mirage im Jahr darauf. Dafür sind die ebenso mantrahaften Stücke von Mirage wie die etwas fetter produzierte zweite Seite von Öhrn + The Liberation. Im Grunde ist das ein cooles Doppelalbum.
Blumiger, bunter wirken da die Songs von → Charlie Hilton, die sonst in der Band Blouse arbeitet, auf ihrem Debüt Palana von ihrem Labelmate Mac Demarco mit Percussion und Hintergrudngesang unterstützt wurde. Während Frau Öhrn eher die garagigere Seite des psychedelischen Gartens erkundet, schaut Hilton in die Sonne, blinzelt und schließt an beinahe orchestralem Pop (hier eher ganz schwer keyboardlastig) und Minibombast à la Beach Boys, Epic Soundtracks und vor allem Lofi-Hop eben von Demarco und ein ganz bisschen auch den guten alten Beck an. Deswegen sind Hiltons Songs keinesfalls fröhlich. Stücke wie Snow oder The Young sind so wundervoll verschneit und sanft stampfend unterwegs, dass sogar das Saxophon erfreuen kann. „But this is not the time, to be alone and worry, it might mean something to the young“, Saxophon, seufz. Gleich nochmal hören. Und nochmal. „I know that you’re non-fictional“. Grins. In die letzten verhallten E-Pianoklänge von Hilton kann ganz prima der erste Song des → Amber Arcades-Albums Fading Lines, das sich anschleichende Come With Me, gemischt werden. Der leichte Schwung wird dann vom Constant’s Dream angenehm ausgebremst und tatsächlich zu Dream Pop. Bevor dann der Titelsong eher wieder in College Rock und sachten Shoegaze Pop über geht. Annelotte de Graaf hat sich von Ben Greenberg (u.a. The Men, Beach Fossils, Destruction Unit) in New York produzieren lassen. Ihre Band wird durch Mitglieder von Quilt und Real Estate gebildet. Vielleicht auch deswegen hat sie als Niederländerin so typische US-amerikanische und auch britische Popmusikeinflüsse an Bord. Amber Arcades ist treibender als Frau Hilton, dennoch viel fluffiger als die schwereren Songs Frau Öhrn. Im Grunde reiht sich Amber Arcades hier in die große kleine Tradition niederländischen Indie Pops der unvergesslichen De Artsen (ja, tatsächlich Die Ärzte, aber so gar nicht DIE Ärzte) und deren Nachfolgern Bettie Serveert und Joost Visser ein. Für Freunde von den eben genannten Frauen über Beach House bis zurück zu Luna, Yo La Tengo, The Bats oder Galaxie 500 und deren Nachfolgeprojekten dürfte(n) Amber Arcades ein Highlight sein. Und jetzt bitte nochmal Constant’s Dream hören.
Aus dem diesbezüglichen und sowieso gesellschaftlich eher unterbewerteten Tagtraum erwache ich dann mit → Palehound leider erfreulicherweise sehr schnell. Es rumpelt, es kracht, es stolpert, es quietscht. Wer ist es? Weiblicher Gesang, leichte Slide Guitar, aber Country hat noch lange nichts beim Palehound verloren. Nicht mal Neo. Ellen Klempner ist noch, nun ja, saujung, aus meiner Perspektive jedenfalls; und wenn ihre sehr vielfältige, manchmal vertrackte, manchmal eingängige Variante von Indie Folk Country berücksichtigt wird, die so viele Referenzen und einen Haufen Wissen und Innovation (oder beides) verkörpert. Healthier Folk ist bester Post-Pixies- oder -Pavement-Rock. Und die Gitarristin und Songschreiberin aus Boston hat sogar einige wunderbar verschluffte Mini-Hits wie den Titelsong oder See Konk produziert. Apropos: Geholfen hat im Studio Gabe Wax, der auch schon Wye Oak, The War On Drugs und Speedy Ortiz vor die Mikrofone gestellt hat. Noch eine ganze Spur rumpeliger und deutlich verquerer, regelrecht angenehm verpeilt sind die → Nots. Die zappeln und ruckeln und treiben dennoch die Beats in eine klar zu erkennende Richtung. Die Damen aus Memphis kann frau schon beruhigt als Post Punk bezeichnen, wobei sie sowohl noisige als auch beinahe discohafte Elemente ausstellen, dabei krachiger und nervöser als Palehound sind, eher wie Sonic Youth auf Speed, schon auch sehr stark an Kathleen Hannas frühe Projekte erinnernd.
„Ist es Zukunft oder ist es Vergangenheit?“ (Mike in Twin Peaks, 3. Staffel, Folge 2)
Das kanadische Quartett → Preoccupations hat schon als Viet Cong für Wirbel gesorgt. Mit ihrem erneuten Debüt bewegen sie sich weiterhin im Land zwischen Übervater Iggy Pop, Joy Division, Gallon Drunk, The National und den Tindersticks. Auch hier wieder bleibt die große Frage, wie die Musik der aus politischen Gründen umbenannten Preoccupations auf Menschen wirkt, die die Achtziger und frühen Neunziger noch nicht selbst popmusikalisch erlebt haben. Welche Form von Erfahrung hier also evoziert wird, während die alten Säckinnen und Säcke (that’s me!) aus Spiralen der Erinnerung (Justus Köhncke) nicht entkommen zu können scheinen. Fest steht, dass Songs wie Anxiety gar nicht traditionslos zu hören sein können (höre auch im Anschluss die Songs der oben besprochenen Silhouettes & Statues-Compilation), sie in ihrem sehr intensiven Drängeln gleichwohl durchaus eine neue Ebene des Sinistren, des Sinatraesken und Ausgehöhltseins (Matt Flegels Gesang röhrt auf genanntem Song nah an Chris Reed von Red Lorry Yellow Lorry oder an bereits erwähntem Stephen Mallinder entlang, s.o., und Röhren heißt hier eben nicht brunftbesessen, sondern tief aus den dickichtigen Wäldern, wo es seltsam ist und die schwarze Hütte die weiße verdrängt, um bei Twin Peaks zu bleiben) praktizieren, das macht schon sehr großen dunklen Spaß. Daher scheinen auch die Klänge der → Wytches zu kommen, wobei das Trio auch auf seinem Zweitling All Your Happy Life dreckiger und näher an Tolstoi denn an Allgemeinpolitischem wirkt. Mehr schleichende Mudhoney oder Union Carbide Productions als ungewaschene Joy Division oder Lorries. Es leiert. Eine gewisse Chicness und Grandezza haben die britischen Wytches bei all dem rock’n’rolligen Krach präsent, höre den Hit A Feeling We Get, das mag auch an der Aufnahme und Abmischung durch den alten Cave-Buddy und Schlagzeuger Jim Sclavunos liegen (Tav Falco, Congo Norwell, Lydia Lunch).
Ebenso wie Jim Sclavunos ist → Hugo Race ein langjähriger Wegbegleiter von Nick Cave. Wobei es für Race phasenweise eher hinderlich schien, dass er mal ein Bad Seed war. Denn so mutierte er in den Musikmedien vor allem Ende der Achtziger, Anfang der Neunziger zu einer Art kleinem Cousin des übermächtigen Cave. Dabei hat sich Race stets intensiver für die Wurzeln des Blues und deren neue Interpretationen und Fortführungen in Richtung Acid Ambient, Elektronik und Experimentelles interessiert. Neben ständigen Verweisen oder sogar Coverversionen auf Races zahlreichen Alben hat der Australier nun ein klares Bekenntnis auf Albumlänge herausgebracht. Was Warren Ellis für Cave geworden ist, scheint Michelangelo Russo für Race geworden zu sein: Bruder im Geiste, Multiinstrumentalist und treibendes Gegenüber. Das Duo nimmt sich die 1917 geborene Blues-Legende John Lee Hooker über acht Stücke vor und entwirft, in einer Nacht in Berlin aufgenommen, luzide Deepness, die mich aufrührt, höre Hobo Blues („When I first thought to hobo’in, hobo’in, I took a freight train to be my friend, oh Lord“…). Ich finde, Race hat sich mehrfach gefunden und wohl auch deswegen einen so hohen Output an vor allem Musik. Diese nur auf Vinyl und Download erhältlichen Blues-Versionen sind das Intensivste und dementsprechend Tranzendenteste, was der Mann seit Jahren produziert hat, sie ätzen und brennen sich förmlich ein und fügen bestens ein in einen der letzten Sätze seiner im letzten Jahr erschienenen autobiographischen Erzählungen: „The struggle is escalating as the globalised world shrinks before your eyes. Every action, every event, has repercussions far and wide.“ (Race 2016: 360) Der Zug rollt, Herr Race erzählt souverän croonend Geschichten und Geschichte und legt im Duo ebenso wie mit der True Spirit zuletzt live seine in den letzten Alben aufgekommene Leichtigkeit wieder ab. Ihm schadet das nicht. Denn der Blues wiegt bekanntlich zentnerschwer, erst Recht in seiner hiesigen ambienten Swampversion.
Weniger Blues als vielmehr Folk, Indie und leichte Indietronics, dafür steht der in Berlin lebende US-amerikanische Songwriter, Musiker und Tausendsassa → Peter Broderick. Jünger als Race – Peter ist 1987, Hugo 1963 geboren – fallen doch auch viele Ähnlichkeiten auf. Beide sind Bestandteile größerer Kollektive und Bands gewesen, spielen solo, haben eigene neue Bands und Projekte, arbeiten zwischen den künstlerischen Disziplinen und als Produzenten, entdecken in der Erfahrung jüngere Talente, zeichnen sich über die letzten Jahre durch einen immensen Output aus und beide sind live immer wieder noch ein Stück intensiver als im Studio und ein Erlebnis. Zudem ist auch der sympathische Broderick aktuell als Duo aktiv. Zusammen mit → David Allred wurde nur mit Geige, Kontrabass und Stimmen ihr sehr schönes Debüt Find The Ways aufgenommen, aus dem ein Song heraussticht, der mich tief berührt, wie es schon des Öfteren bei den Songs von Broderick der Fall war – ob nun live oder aus der ‚Konserve’. Hier ist es Hey Stranger, bei dem Brodericks immer wieder erlösende Melancholie unglaublich stark wirkt. Spannend erscheint mir, dass seine Stimme natürlich alles markiert, es aber auch mit eher klassischen Instrumenten letztlich zum typischen Broderick-Empfinden kommen kann. Offenbar ein Ziel, dass Allred und Broderick in dieser kongenialen Besetzung auch vor Augen und vor allem Ohren hatten.
Auf die Ohren und einen gewissen Anschluss zu den einleitenden Überlegungen zu Gewalt gibt es zum vorläufigen Abschied: → Friends of Gas aus München. Nicht nur in Klang und Haltung sind diese vielen, sehr tollen jungen deutschsprachigen Post-Post-Punk-Bands wie Candelilla, Karies, Messer, Die Nerven, Die Heiterkeit ähnlich, Max Rieger von Die Nerven und All Diese Gewalt hat sie auch gleich mikrofoniert und produziert, live auf der Bühne, ohne Publikum. Der Club wurde zum Studio für Band und Produzent. „Mein Körper ist mein Template. Dein Körper ist mein Tablet.“ Zick. Zack. Boller. Und los. Krach. Veronica Burnuthian schreit. Erinnert fatal stark an Thalia Zedek zu deren Gesangszeiten bei Live Skull und vielleicht noch gerade so eben Come – ebnso klingen die eben besprochenen Wytches und deren Kristian Bell auch nochmals bei mir an. Dieser noiserockige Eindruck wird freilich durch die teilweise englischen Texte verstärkt. Reibeisen eben. Später dann, auf Ewiges Haus, flüstert sie. Es ist leicht, sich vorzustellen, wie Friends of Gas von Gegensätzen lebt, zusammen- und auseinanderspringen (Kollektives Träumen), wie jede/r für sich und doch auch alle als Organ gemeinsam postrocken. Musik, die nervt, Gesang, der nervt, Texte, die nerven. „So soll es sein“, um nochmal Patrick Wagners Gewalt zu zitieren, die ich mir sehr gut als Package mit Friends of Gas vorstellen kann.
Kleine, mittlere und große Transzendenzen
Für alle dieses Mal hier vorgestellte Musik, die bei, an und in mir hängen geblieben ist, gilt, dass sie mich, mal mehr, mal weniger in Zwischenräume, Fluchten aus dem Alltag versetzt, so wie es der französische Ethnologe Marc Augé jüngst in seiner Liebeserklärung an das klassische Pariser Bistro für dessen Besucher fein beobachtend beschrieben hat: „Sie alle haben das Bedürfnis, zwischen An- und Abwesenheit zu changieren, sich wie zu Hause und zugleich auswärts zu fühlen, aufgenommen und nicht weiter beachtet zu werden.“ (Augé 2016: 46). Und so driften wir weiter. „Wie in jeder Familie erzählt man sich auch hier Geschichten, die so nie stattgefunden haben, weil man die Gegenwart erträglich gestalten will. Die Popgeschichte ist nie so divers und entspannt verlaufen wie beim Familientreffen der Gorillaz. Ist das jetzt fake? Zweimal nein. Erstens: Es hat ja stattgefunden, real, auf vielen Bühnen. Zweitens: Die imaginierte Familie als alternative Erzählung für Popgeschichte ist am Ende nur zur Hälfte erfunden. [Hervorh. i. O., C.J.]“ (Müller/Raffeiner 2017: 31)
Text
Christoph Jacke
Fotografie
© Die Aufhebung
[notification type=“success_alert“ title=““]Abgesang mit weiteren Zitaten, die während des Verfassens aufgetaucht und passend sind (dafür sind wir doch hier):[/notification]
Kultur beginnt damit, Nein sagen zu können, und vollendet sich darin, aus diesem Nein positive Effekte zu gewinnen. Genau das heißt: kultivieren.
(Baecker 2014: 8)
Kennzeichen des kultivierten Menschen ist nicht dessen Einklang mit sich selbst, sondern dessen reflexive, um nicht zu sagen rebellische Unruhe.
(Baecker 2013: 12)
Nenne Kultur die Anerkennung der Position eines Beobachters unter den Gesichtspunkt der Kontingenz dieser Position. […] Nenne Gesellschaft den Anlass, die Art und Weise und das Ergebnis der Auseinandersetzung dieser Beobachter um ihre Position zueinander. […] Nenne Wissen jeden Einsatz innerhalb dieser Auseinandersetzung. Nenne Nichtwissen das Wissen um ein Nichtwissen. […] Unterscheide Beobachter anhand der Unterscheidungen, die sie treffen. [Hervorh. i. O., C.J.]
(Baecker 2013: 17)
In einem Schwarm ist es nicht unmöglich, ‚Nein’ zu sagen. Unser Nein ist schlicht irrelevant. Wir können unsere Verweigerung ausdrücken, unsere Rebellion und unsere Unangepasstheit. Weder werden wir auf diese Weise die Richtung des Schwarms verändern noch die Art und Weise beeinflussen, in der das Gehirn des Schwarms Informationen produziert.
(Berardi 2015: 32)
[notification type=“success_alert“ title=““]Outro zum Auftakt für Weiteres[/notification]
Kopfhörer auf.
Ein halber Joint, der letzte Rest von letzter Nacht.
Der laute Bass schickt ihn in einen Film.
Er schlurft mit seinen Sneakern.
Und wiegt sich in den Hüften.
Die Kinder an der Haltestelle
Lachen wie an jedem Tag.
Er schaut geflissentlich vorbei.
Doch das bringt nichts.
Kapuze hoch, und weiter geht’s.
Er bläst Rauchringe.
Singt laut Wu-Tang.
Hasst sich selbst.
(Tempest 2016: 11, aus „Teiresias“)
[togglegroup][toggle title=“Quellen“]
AHA, Laura (2017): „Fusion ist wie Weihnachten“. Eine interdisziplinäre Betrachtung des Fusion Festivals als Ritual einer „Unsichtbaren Religion“. In: Janus, Richard; Fuchs, Florian; Schroeter-Wittke, Harald (Hrsg.): Massen und Masken. Kulturwissenschaftliche und theologische Annäherungen. Wiesbaden: Springer VS, S. 125-148.
AUGÉ, Marc (2016): Das Pariser Bistro. Eine Liebeserklärung. Berlin: Matthes & Seitz.
BAECKER, Dirk (2013): Beobachter unter sich. Eine Kulturtheorie. Berlin: Suhrkamp.
BAECKER, Dirk (2014): Kulturkalkül. Berlin: Merve.
BAUMAN, Zygmunt (2016): Die Angst der anderen. Ein Essay über Migration und Panikmache. Berlin: Suhrkamp.
BAUMAN, Zygmunt; Lyon, David (2013): Daten, Drohnen, Disziplin. Ein Gespräch über flüchtige Überwachung. Berlin: Suhrkamp.
BERARDI, Franco ‚Bifo’ (2015): Der Aufstand. Über Poesie und Finanzwirtschaft. Berlin: Matthes & Seitz.
DAX, Max (2017): „Nichts lullert einen so richtig mehr ein“. Bohren und der Club of Gore sind ein großes Geheimnis: Die Bandmitglieder Christoph Clöser und Morten Gass gestatten Einblicke. In: Frankfurter Rundschau. 73. Jg. Nr. 15 vom 18.01.2017, S. 32-33. Online: http://www.fr.de/kultur/musik/bohren-und-der-club-of-gore-nichts-lullert-einen-so-richtig-mehr-ein-a-739919 (Abruf: 21.02.2017)
FLATH, Beate; Jacke, Christoph (2017): Das Quasireligiöse im Kontext von Massenevents der Popmusik. Eine Spurensuche. In: Janus, Richard; Fuchs, Florian; Schroeter-Wittke, Harald (Hrsg.): Massen und Masken. Kulturwissenschaftliche und theologische Annäherungen. Wiesbaden: Springer VS, S. 25-46.
JACKE, Christoph (2013): Meta-Stars: Ausdifferenzierung und Reflexivierung von prominenten Medienfiguren als Stars in der Popmusik. In: Robertson-von Trotha, Caroline Y. (Hrsg.): Celebrity Culture. Stars in der Mediengesellschaft. Baden-Baden: Nomos, S. 73-101.
JACKE, Christoph (2016): Big Black: Songs about Fucking. In: Engelmann, Jonas (Hrsg.): Damaged Goods. 150 Einträge in die Punk-Geschichte. Mainz: Ventil, S. 201-203.
KNIOLA, Till (2017): No escape from noise: ‚geräuschmusik’ made in Germany. In: Ahlers, Michael; Jacke, Christoph (Hrsg.): Perspectives on German Popular Music. Ashgate Popular and Folk Music Series. London/New York: Routledge, S. 123-127.
KRÄMER, Sybille (2008): Medium, Bote, Übertragung. Kleine Metaphysik der Medialität. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
MÜLLER, Tobi; Raffeiner, Arno (2017): Gorillaz. Widerstehen der Wirklichkeit. In: Spex. Nr. 374 (Mai/Juni 2017), S. 26-35.
RACE, Hugo (2016): Road Series. Melbourne: Transit Lounge.
RAFMAN, Jon (2011): Introduction. In: Ders.: The Nine Eyes of Google Street View. O.O.: Jean Boite Editions, o.S.
RECK, Hans Ulrich (2016): Erschöpfung. Dissonante Perspektiven. In: Kunstforum International. Band 243: Postdigital 2: Erscheinungsformen und Ausbreitung eines Phänomens, S. 34-37.
SCHINDLER, Jörg (2016): Die steile Karriere des Wörtchens „selbst“. Eine Konsequenz des Individualismus ist die Einsamkeit. Mit der Angst, die daraus folgt, ist jeder mit sich noch mehr alleine. In: Frankfurter Rundschau. 72. Jg. Nr. 194/2016, S. 22-23.
STEGEMANN, Bernd (2017): Das Gespenst des Populismus. Ein Essay zur politischen Dramaturgie. 2. Auflage. Berlin: Theater der Zeit.
STILLBAUER, Thomas (2016): Gepflegte Panik. ‚Head Carrier’ heißt das neue Album der Pixies und ist zum Verlieben schön in seiner Rauheit. In: Frankfurter Rundschau. 72. Jg. Nr. 227 vom 28.09.2016, S. 33. Online: http://www.fr.de/kultur/musik/neues-album-head-carrier-vertraute-rauheit-der-pixies-a-307743 (Abruf: 21.02.2017)
SURALL, Matthias (2016): „And God is never far away“. Spannende Theologie im Werk von Nick Cave. Berlin und Münster: LIT.
TEMPEST, Kate (2016): Hold Your Own. Gedichte. Berlin: Suhrkamp.
THALMAIR, Franz (2016): Postdigital 2. Erscheinungsformen und Ausbreitung eines Phänomens. In: Kunstforum International. Band 243: Postdigital 2: Erscheinungsformen und Ausbreitung eines Phänomens, S. 40-55.
TURNER, Victor (2005 [1969]): Das Ritual. Struktur und Anti-Struktur. Neuauflage. Frankfurt/M./New York: Campus.
WELBERRY, Karen; Dalziell, Tanya (Hrsg.) (2009): Cultural Seeds. Essays on the Work of Nick Cave. Farnham and Burlington: Ashgate.[/toggle][toggle title=“Diskografie“]
NICK CAVE AND THE BAD SEEDS, “SKELETON TREE”, BAD SEED LTD., 2016.
NICK CAVE AND THE BAD SEEDS, “LOVELY CREATURES – THE BEST OF NICK CAVE AND THE BAD SEEDS”, MUTE/WARNER, 2017.
PIXIES, “HEAD CARRIER”, PIAS, 2016.
V/A, “STILL IN A DREAM: A STORY OF SHOEGAZE 1988-1995”, CHERRY RED, 2016.
V/A, “C87”, CHERRY RED, 2016.
V/A, “C88”, CHERRY RED, 2017.
V/A, “ANOTHER SPLASH OF COLOUR. NEW PSYCHEDELIA IN BRITAIN 1980-1985”, CHERRY RED, 2016.
V/A, “CLOSE TO THE NOISE FLOOR. FORMATIVE UK ELECTRONICA 1975-1984. EXCURSIONS IN PROTO-SYNTH POP, DIY TECHNO AND AMBIENT EXPLORATION.”, CHERRY RED, 2016.
V/A, “SILHOUETTES & STATUES”, CHERRY RED, 2017.
TUXEDOMOON/CULT WITH NO NAME, “BLUE VELVET REVISITED”, CRAMMED, 2015.
TUXEDOMOON, “HALF-MUTE + GIVE ME NEW NOISE: HALF-MUTE REFLECTED”, CRAMMED, 2016.
TUXEDOMOON/CULT WITH NO NAME, “BLUE VELVET REVISITED”, CRAMMED, 2015.
VÉRONIQUE VINCENT & AKSAK MABOUL – 16 VERSIONS OF EX-FUTUR, CRAMMED, 2016.
BOHREN UND DER CLUB OF GORE, “BOHREN FOR BEGINNERS”, PIAS, 2016.
JULIANNA BARWICK, “WILL”, DEAD OCEANS, 2016.
JOE VOLK, “HAPPENINGS AND KILLINGS”, GLITTERHOUSE, 2016.
EXPLOSIONS IN THE SKY, “THE WILDERNESS”, BELLA UNION, 2016.
PUBLIC MEMORY, “WUTHERING DRUM”, FELTE, 2016.
NATALIE BERIDZE, “GULIAGAVA”, MONIKA ENTERPRISE, 2016
EXPLODED VIEW, “EXPLODED VIEW”, SACRED BONES, 2016.
MASHA QRELLA, “KEYS”, MORR, 2016.
ISAN, “GLASS BIRD MOVEMENT”, MORR, 2016.
WOLFMAN, “MODERN AGE”, IRASCIBLE, 2016.
WRANGLER, “WHITE GLUE”, MEME TUNE, 2016.
BRIAN ENO, “THE SHIP”, WARP, 2016.
BRIAN ENO, “REFLECTION”, WARP, 2017.
TEHO TEARDO & BLIXA BARGELD, “NERISSIMO”, SPECULA, 2016.
RITORNELL, “IF NINE WAS EIGHT”, KARAOKE KALK, 2016.
STIAN WESTERHUS, “AMPUTATION”, HOUSE OF MYTHOLOGY, 2016.
JOEP BEVING, “SOLIPSISM”, I ARE GIANT, 2016.
JOEP BEVING, “PREHENSIONS”, DEUTSCHE GRAMMOPHON, 2017.
CHRISTOPHER TIGNOR, “ALONG A VANISHING PLANE”, WESTERN VINLY, 2016.
CHRISTOPHER BISSONNETTE, “PITCH, PAPER & FOIL”, KRANKY, 2015.
MJ GUIDER, “PRECIOUS SYSTEMS”, KRANKY, 2016.
LOSCIL, “MONUMENT BUILDERS”, KRANKY, 2016.
OVAL, “POPP”, UOVOO, 2016.
SILVER APPLES, “CLINGING TO A DREAM”, CHICKENCOOG, 2016.
JOSEFIN ÖHRN + THE LIBERATION, “MIRAGE”, ROCKET, 2016.
CHARLIE HILTON, “PALANA”, CAPTURED TRACKS, 2016.
AMBER ARCADES, “FADING LINES”, HEAVENLY, 2016.
PALEHOUND, “DRY FOOD”, HEAVENLY, 2016.
NOTS, “COSMETIC”, HEAVENLY, 2016.
PREOCCUPATIONS, “PREOCCUPATIONS”, JAGJAGUWAR, 2016.
THE WYTCHES, “ALL YOUR HAPPY LIFE”, HEAVENLY, 2016
HUGO RACE & MICHELANGELO RUSSO, “JOHN LEE HOOKER’S WORLD TODAY”, GLITTERHOUSE, 2017.
ALLRED & BRODERICK – “FIND THE WAYS”, ERASED TAPES, 2017 .
FRIENDS OF GAS, “FATAL SCHWACH”, STAATSAKT, 2016.[/toggle][toggle title=“Hör|Spiel“]
[/toggle][/togglegroup]
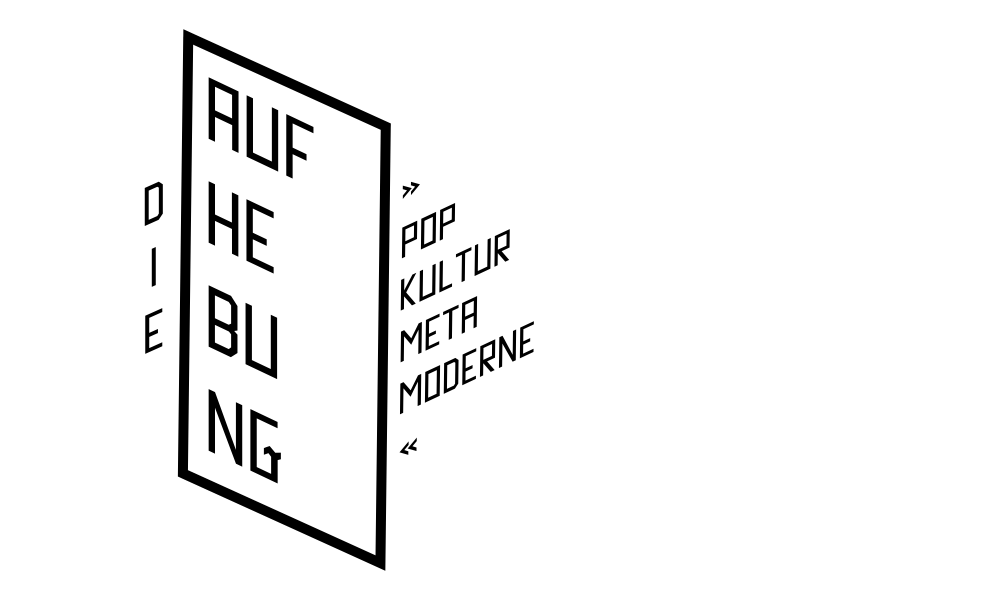


One Comment